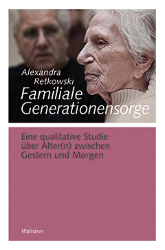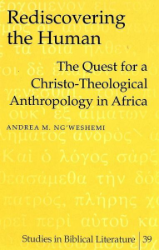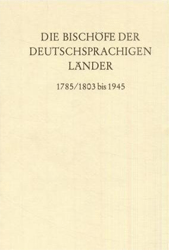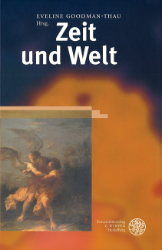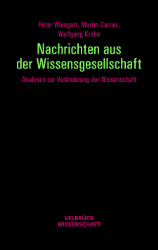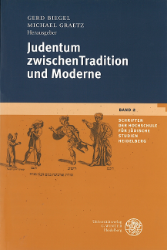Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.

Arnold, Rafael
Spracharkaden
Die Sprache der sephardischen Juden in Italien im 16. und 17. Jahrhundert. Viele iberische Juden fanden in Italien Zuflucht, wo sich neue Zentren sephardischer Kultur entwickelten. Die Arbeit untersucht auf Basis eines breitgefächertes Korpus von Quellentexten umfassend die dabei entstandene Emigrantenvarietät des Spanischen mitsamt der hebräischen und romanischen Interferenzen und beleuchtet den kulturellen Wandlungsprozess, der im 16. und 17. Jahrhundert stattfand. - Nach ihrer Vertreibung aus Spanien und Portugal fanden viele iberische Juden in Italien Zuflucht, wo sich unter anderem in Venedig, Ferrara und Livorno neue Zentren sephardischer Kultur entwickelten. Anhand einer zuvor in ihrer Reichhaltigkeit nicht bekannten Literatur sowie unter Verwendung handschriftlicher und grabinschriftlicher, teilweise bisher unveröffentlichter Zeugnisse wird die Sprache der sephardischen Juden in Italien im 16.-18. Jahrhundert und in größeren Zusammenhängen erforscht. Einen besonderen Schwerpunkt bilden Übersetzungen und Übersetzungsmethoden sakraler Texte, zu denen die sogenannte "Ferrara-Bibel" (1553) und die venezianische "Haggada" (1619) gehören. Die Beschreibung einer durch die Vertreibung aus dem Mutterland entstandenen Emigrantenvarietät des Spanischen mitsamt der hebräischen und romanischen Interferenzen stellt dabei nur den linguistischen Aspekt einer Forschungsarbeit von weitreichendem kulturgeschichtlichem Interesse dar. - Das Untersuchungsfeld der Arbeit lässt sich als eine Schnittmenge des 'Jüdischen' und 'Romanischen' beschreiben. Um möglichst viele Aspekte der von den Sepharden verwendeten Sprache zu erfassen, wurde dieser Untersuchung ein breitgefächertes Textkorpus zeitgenössischer Quellen aus italienischen Bibliotheken und Archiven zugrundegelegt. Nach einem kurzen historischen Abriss über die Vertreibung der Sepharden und die Niederlassung in verschiedenen Städten Italiens werden zunächst Äußerungen von Nichtjuden und Juden über die Sprachen der Sepharden aufgeführt, bevor dann die Texte folgen, die von sephardischen Juden selbst verfasst wurden. In dem vielfältigen Panorama unterschiedlicher Texte und Textgattungen lassen sich zwei Schwerpunkte benennen: Den einen bilden Druckwerke, die in Italien veröffentlicht wurden und zum Ruhm des italienisch- jüdischen Buchdrucks beigetragen haben, dem ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Den anderen Schwerpunkt bilden handschriftliche, zum Teil bis heute nicht veröffentlichte Texte. Es handelt sich bei dem Textkorpus um ein sehr breites Spektrum von Sprachzeugnissen sephardischer Juden in Italien, das von hebräisch geschriebenen Büchern bis zu Texten in literarischem Spanisch, Portugiesisch oder Italienisch reicht, die sich nicht von solchen christlicher Verfasser unterscheiden lassen. Zu den handschriftlichen Zeugnissen zählen Protokolle des venezianischen Inquisitionstribunals, Briefe, Gedichte, rabbinische Korrespondenz (die sogenannten 'responsa') und schließlich unveröffentlichte Testamente sephardischer Juden, die sich im Staatsarchiv Venedig befinden. Die Analyse dieser Texte verspricht Hinweise auch auf die gesprochene Sprache der Sepharden. Vor allem kann man hier mit mehr Interferenzen zwischen den romanischen Sprachen (und in geringem Maße auch mit dem Hebräischen) rechnen, nicht zuletzt, weil diese Texte zum Teil, wie im Falle der Testamente, auch von weniger gebildeten oder schriftgewandten Personen stammen. Eine weitere Textsorte, die untersucht wird, sind Grabinschriften, die in Stein gemeißelt wurden. Der jüdische Friedhof auf dem Lido von Venedig weist neben den traditionellen Epitaphien in hebräischer Sprache und Schrift eine große Anzahl von Grabsteinen auf, die Inschriften in lateinischen Buchstaben tragen. Teilweise sind es nur kurze Zusätze zur hebräischen Inschrift, teilweise sind es aber auch elaborierte Texte in spanischer, portugiesischer oder italienischer Sprache. So zeigt sich allein innerhalb dieser Textgattung ein Spektrum, das von einsprachig hebräischen über gemischtsprachige Inschriften voller Interterenzen der romanischen Einzelsprachen bis hin zu einsprachigen Inskriptionen in literarischer Sprache reicht. Anhand der hier dargestellten Vielzahl vielfaltiger Texte soll nicht nur die Sprache der Sepharden mit ihren Besonderheiten dargestellt werden, wie sie in den ersten beiden Jahrhunderten nach der Vertreibung in Italien beschaffen war, sondern auch ein kultureller Wandlungsprozess, der im 16. und 17. Jahrhundert stattgefunden hat, nachvollzogen werden. In diesem Prozess spielten wiederum die Marranen eine entscheidende Rolle. Dabei sind Schrift- und Sprachwechsel nicht nur als Ausdruck dieses Prozesses, sondern zugleich als sein Motor zu verstehen. 388 Seiten mit 22 Abb., broschiert (Schriften der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg; Band 7/Universitätsverlag Winter 2006)
Bestell-Nr.: 14898
ISBN-13: 9783825350048
ISBN-10: 3825350045
Erscheinungsjahr: 2006
ISBN-13: 9783825350048
ISBN-10: 3825350045
Erscheinungsjahr: 2006
Bindungsart: broschiert
Umfang: 388 Seiten mit 22 Abb.
Gewicht: 653 g
Verlag: Universitätsverlag Winter
Umfang: 388 Seiten mit 22 Abb.
Gewicht: 653 g
Verlag: Universitätsverlag Winter
Reihe: Schriften der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg
Autor*in: Rafael Arnold
Sprachen: Deutsch, Latein
Zustand: Neu
Autor*in: Rafael Arnold
Sprachen: Deutsch, Latein
Zustand: Neu
Weitere Bücher der Reihe »Schriften der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg«

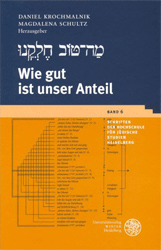


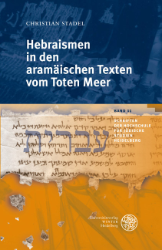
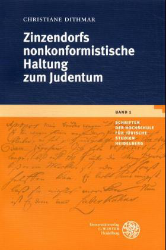
Weitere Bücher im Sachgebiet »Hebräische und jiddische Philologie«
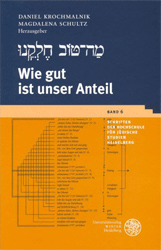

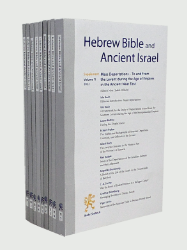
HeBAI - Hebrew Bible and Ancient Israel. Vol. 10 & 11 (2021/2022)
Neun Ausgaben: Zwei vollständige Jahrgänge plus Supplement
Neun Ausgaben: Zwei vollständige Jahrgänge plus Supplement

Houtman, Alberdina [Dineke]
Mishnah und Tosefta
[Main volume and supplement, complete]. A Synoptic Comparison of the Tractates …
Mishnah und Tosefta
[Main volume and supplement, complete]. A Synoptic Comparison of the Tractates …