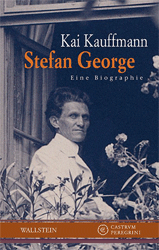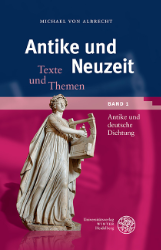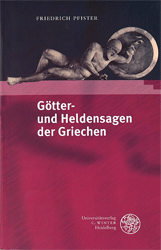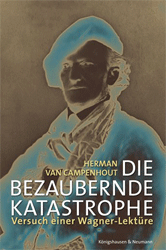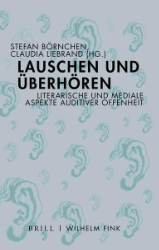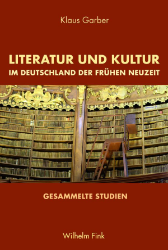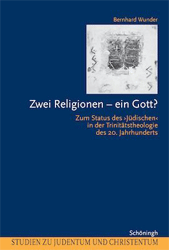Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.

Wunder, Bernhard
Konstruktion und Rezeption der Theologie Walter Benjamins
These I und das "Theologisch-politische Fragment". Der Autor vertritt die These, dass die theologische Terminologie Benjamins auf ihre literarischen Konstruktionsprinzipien hin untersucht werden muß, bevor sie rezipiert werden kann, und analysier die beiden Texte sowohl auf ihre begriffsbildenden Grundlagen hin als auch auf ihre Kontexte. - Die theologische Terminologie Walter Benjamins muß zuerst auf ihre literarischen Konstruktionsprinzipien hin untersucht werden, bevor sie rezipiert werden kann. Das ist die Grundthese dieser Arbeit. Kostprobe: Was soll etwa die Rede von Studium und Umkehr als messianische Kategorien (vgl. II,2 437), die Rede von Theologie als kleinem häßlichen Zwerg (vgl. I,2 693) in einer christlichen Theologie? Was hat das Ewige als Rüsche am Kleid zu suchen (vgl. V,1 578)? Braucht man einen Engel der Geschichte (vgl. 1,2 698) um ihre katastrophische Entwicklung zu erkennen? In welcher Weise rückt also das "Theologische" bei Walter Benjamin und in welcher Weise rückt Benjamin in die heutige christliche Theologie ein? Erstmals geht eine Arbeit über Walter Benjamin von zwei Texten aus, die unstrittig für zentral gehalten werden, jedoch nie zum Gegenstand einer eigenen Untersuchung wurden: die These I seiner Geschichtsthesen und das "Theologisch-politische Fragment". Die minutiöse Analyse dieser Texte stellt zugleich eine feinfühlige Einführung in das Gesamtwerk Benjamins als auch einen Einblick in seine Rezeptionsarbeit dar. Der Leser darf gespannt sein auf bisher unbekannte Überraschungen der Auseinandersetzungen Benjamins mit Carl Schmitt, Ernst Bloch und Franz Kafka. Des weiteren gibt die Arbeit einen bisher völlig einmaligen Überblick über den Stand und Status der erst beginnenden christlichen Rezeption dieses großen Denkers unseres Jahrhunderts für den deutschsprachigen Raum. - Der Autor analysiert Benjamins Begriffe der Theologie und des Messianismus minutiös und führt sie der Diskussion insbesondere mit der christlichen Fragestellung zu. Hinreichender Grund ist in der Auseinandersetzung Benjamins mit der von Carl Schmitt als katholisch verstandenen Position zu sehen, die im Zusammenhang der These I entfaltet wird. Die überaus aufschlußreiche Auseinandersetzung Benjamins mit Ernst Bloch und seiner Vermischung jüdischer und christlicher Topoi stellt im Verein mit Benjamins Kafka-Rezeption vor allem das 'Theologisch-politische Fragment' auf eine fundierte Verstehensbasis. 173 Seiten, broschiert (Epistemata. Reihe Philosophie; Band 223/Königshausen & Neumann 1997) leichte Lagerspuren
Bestell-Nr.: 25314
ISBN-13: 9783826013812
ISBN-10: 3826013816
Erscheinungsjahr: 1997
ISBN-13: 9783826013812
ISBN-10: 3826013816
Erscheinungsjahr: 1997
Reihe: Epistemata. Reihe Philosophie
Autor*in: Bernhard Wunder
Sprache: Deutsch
Zustand: Sehr gut, leichte Lagerspuren
Autor*in: Bernhard Wunder
Sprache: Deutsch
Zustand: Sehr gut, leichte Lagerspuren
Weitere Bücher der Reihe »Epistemata. Reihe Philosophie«

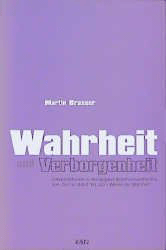
Brasser, Martin
Wahrheit und Verborgenheit
Interpretationen zu Heideggers Wahrheitsverständnis von "Sein und Zeit" bis …
Wahrheit und Verborgenheit
Interpretationen zu Heideggers Wahrheitsverständnis von "Sein und Zeit" bis …

Perica, Ivana
Die privat-öffentliche Achse des Politischen
Das Unvernehmen zwischen Hannah Arendt und Jacques Rancière
Die privat-öffentliche Achse des Politischen
Das Unvernehmen zwischen Hannah Arendt und Jacques Rancière

Venus, Jochen
Referenzlose Simulation?
Argumentationsstrukturen postmoderner Medientheorie am Beispiel von Jean Baudrillard …
Referenzlose Simulation?
Argumentationsstrukturen postmoderner Medientheorie am Beispiel von Jean Baudrillard …

Polke, Irene
Selbstreflexion im Spiegel des Anderen
Eine wirkungsgeschichtliche Studie zum Hellenismusbild [Christian Gottlob] Heynes …
Selbstreflexion im Spiegel des Anderen
Eine wirkungsgeschichtliche Studie zum Hellenismusbild [Christian Gottlob] Heynes …
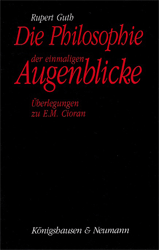
Weitere Bücher im Sachgebiet »Walter Benjamin«
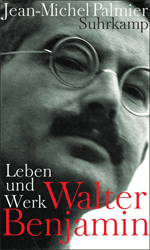
Palmier, Jean-Michel
Walter Benjamin
Lumpensammler, Engel und bucklicht Männlein. Ästhetik und Politik bei Walter …
Walter Benjamin
Lumpensammler, Engel und bucklicht Männlein. Ästhetik und Politik bei Walter …
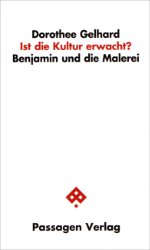
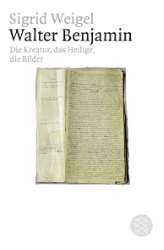


Garber, Klaus
Rezeption und Rettung
Drei Studien zu Walter Benjamin. [Garleff Zacharias-Langhans zum 50. Geburtstag] …
Rezeption und Rettung
Drei Studien zu Walter Benjamin. [Garleff Zacharias-Langhans zum 50. Geburtstag] …
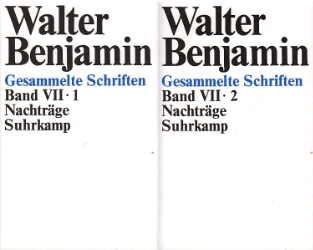
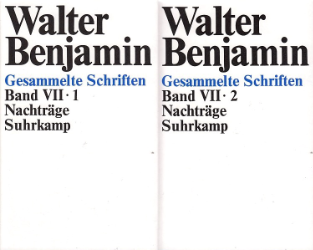
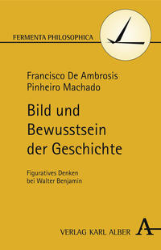
De Ambrosis, Francisco/Pinheiro Machado
Bild und Bewusstsein der Geschichte
Figuratives Denken bei Walter Benjamin
Bild und Bewusstsein der Geschichte
Figuratives Denken bei Walter Benjamin