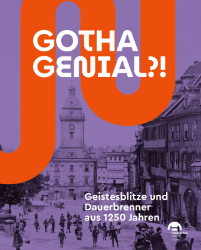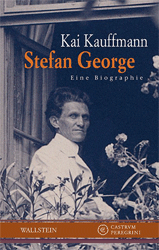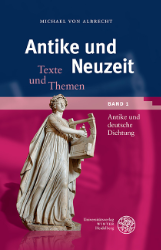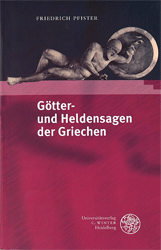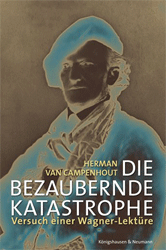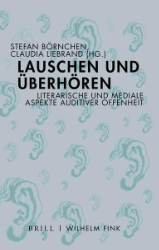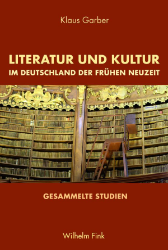Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.

Dekonstruieren und doch erzählen
Polnische und andere Geschichten. Hrsg. von Jürgen Heyde, Karsten Holste, Dietlind Hüchtker, Yvonne Kleinmann und Katrin Steffen.Wie kann Geschichte nach der Postmoderne erzählt werden? Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes halten am Dekonstruieren fest und stellen sich doch der Herausforderung, weiter zu erzählen. In Form von 43 kurzen Essays widmen sie sich den Möglichkeiten des historischen Darstellens, das sie anhand von ausgewählten Kontroversen und unterschiedlichen Miniaturen konkretisieren. Der Band gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Erzählungen überdenken; 2. Erinnerungen historisieren; 3. Wahrnehmungen kontextualisieren; 4. Räume und Zeiten vermessen; 5. Wissenschaft reflektieren. Die Essays befassen sich mit folgenden Fragen: Wie werden Räume, Zeiten und Epochen konstruiert, und mit welchen Mitteln können sie neu vermessen werden? Wie fließen Erinnerungen in Darstellungen ein und wie lassen sie sich historisieren? Auf welche Weise werden historische Ereignisse wahrgenommen, und wie wird Geschichte visualisiert? Welche Alternativen können zu bestehenden Geschichtserzählungen entwickelt werden? Wie werden die Praktiken der Wissenschaft und die Herstellung von historischem Wissen reflektiert? - Aus dem Inhalt: Jill Gossmann: Stalingrad. Ein Knie erinnert sich. Mythen dekonstruieren und dennoch erzählen? - Damien Tricoire: Die Selbstkolonisierung Europas oder: Wie lässt sich eine andere Geschichte der Aufklärung erzählen? - Jürgen Heyde: Lemberg 1440. Ethnizität in der Vormoderne. - Martin Schulze Wessel: Identitäten und Loyalitäten im Zeitalter (neo)imperialer Politik. Die Tschechoslowakei 1938 und die Ukraine heute im Vergleich. - Hans Henning Hahn: Der deutsche Kolonialdiskurs und Osteuropa. - Christine Bovermann: Der Weltkrieg als Chance. Zur Entstehung von zionistischen Mädchenvereinen im Deutschen Kaiserreich. - Karsten Holste: "Der Mann im Mond" oder: Der deutsch-polnische Nationalitätenkonflikt als Eifersuchtsdrama. - Dietlind Hüchtker: Männlichkeit im Sozialismus und Pop in Polen. Ein Fundstück. - Haiina Beresneviciûte-Nosálová: Czech National Culture in Mid-Nineteenth-Century Brno. The Efforts of Several Individuais or a Fashion among Established Elites? - Karin Friedrich: Life-Writing in the Polish-Lithuanian Commonwealth. Reflections on Magnate Ego-Documents. - Hartmut Rüdiger Peter: Ivan Il'in - der Meisterdenker? Anmerkungen zu einer Wiederentdeckung. - Monika Wienfort: Marion Gräfin Dönhoff und die Stilisierung des ländlichen Adelslebens. - Patrick Wagner: Der Führer schreibt Geschichte. Die Selbsthistorisierung des Nationalsozialismus in Hitlers Gedenktagsreden. - Stephan Stach: »Würden die Helden des Ghettos leben ...«. Über die Aneignung der Erinnerung an den Warschauer Ghettoaufstand in Polen. - Katrin Steffen: Polnische Geschichte oder universelle Erzählung? Der Film "Ida". - Wlodzimierz Borodziej/Joachim von Puttkamer: Jüdische Geschichte erzählen. Ein gemeinsamer Rundgang durch das Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau. - Witold Molik: Der Wandel der historischen Narrative in der Stadtgeschichte der sogenannten »Wiedergewonnenen Gebiete«. Das Beispiel von Strzelce Krajenskie/Friedeberg (Neumark). - Cornelius Torp: Die umkämpfte Erinnerung an »Sand Creek«. - Andreas Pecar: Mariensäulen und ihre politischen Botschaften. - Hans-Jürgen Bömelburg: Jenseits von »Blutgericht« und »Tumult«. Zuschreibungen von »deutsch« und »polnisch« unter Thorner Stadtbürgern im 18. Jahrhundert. - Heinz-Gerhard Haupt: Gewalterfahrungen und Gewaltwahrnehmungen im Frankreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts. - Matthias Uhl: Der einsame Diktator - Stalins Datsche in Kuncevo. - Dirk Suckow: Das Ansehen des Flusses. Die Wolga als Metapher für Rückständigkeit, Fortschritt und verwirklichte Utopie. - Robert Traba: "Birbante rocco!" Die polnische Entdeckung Siziliens. - Burkhard Schnepel: Gedanken zu einer Geschichte der Nacht. - Hubert Orlowski: »Geboren neunzehnhunderttraurig« oder: Von der Ungeduld der Erkenntnis. - Robert Frost: Parcelling up the Rogues. On Writing the History of Political Unions. - René Leboutte: Für eine Dekonstruktion der Erzählungen vom »Prozess der europäischen Integration«. - Miroslav Hroch: Braucht Europa ein gemeinsames Geschichtsbuch? Oder: Die Identitäten stützende Kraft der Banalitäten. - Yvonne Kleinmann: Über die Substanz polnischer Geschichte. Polen als Gegenstand von "Area Studies"? - Kai Struve: Räume der Nation. Polen im 19. Jahrhundert. - Hanna Kozinska-Witt: Juden in den Städten oder: Zwei Fragen an die Stadtgeschichte. - Wojciech Kriegseisen: "Die Zweite Reformation" in Polen-Litauen. Trugschluss oder Tatsache? Ein kritischer Essay zur Terminologie. - Henryk Samsonowicz: Zur Bedeutung der Ostsee für die deutsch-polnischen Beziehungen im Mittelalter. - Chris Hann: Wo und wann war Eurasien? Kontrastierende Geschichtskonstruktionen auf kontinentaler Ebene. - Giuseppe Veltri: Jüdische Wissenskulturen und Wissenschaftsmigration. Drei Thesen. - Andreas Lawaty: Literatur und Geschichte im Briefwechsel. - Stefan Troebst: Von Kokoschka über Magocsi zu Modigliani. Zwangsmigration in Ostmitteleuropa zwischen Zweitem Weltkrieg und Kaltem Krieg. - Rolf Petri: Krieg und Erzählung. - Dirk H. Müller: Verkürzte Vorbemerkungen zu einer Frühgeschichte der Quantenphysik. - Manfred Hettling: Geschichtsschreibung im Bann des Subjektiven? - Heinz Reif: »Die Lücke, die der Teufel lässt«. Zum Nutzen der Literatur für die Geschichte. - Milos Rezník: Sammeln Sie Punkte? Eine (leider auch) wissenschaftliche Dimension des »Lebens«. 359 Seiten mit 22 Abb., gebunden (Polen: Kultur - Geschichte - Gesellschaft/Poland: Culture - History - Society; Band 2/Wallstein Verlag 2015) leichte Lagerspuren
Bestell-Nr.: 128470
ISBN-13: 9783835317727
ISBN-10: 3835317725
Erscheinungsjahr: 2015
ISBN-13: 9783835317727
ISBN-10: 3835317725
Erscheinungsjahr: 2015
Reihe: Polen: Kultur - Geschichte - Gesellschaft/Poland: Culture - History - Society
Herausgeber*innen: Karsten Holste, Dietlind Hüchtker, Yvonne Kleinmann, Katrin Steffen, Jürgen Heyde
Sprache: Deutsch
Zustand: Wie neu, leichte Lagerspuren
Herausgeber*innen: Karsten Holste, Dietlind Hüchtker, Yvonne Kleinmann, Katrin Steffen, Jürgen Heyde
Sprache: Deutsch
Zustand: Wie neu, leichte Lagerspuren
Weitere Bücher im Sachgebiet »Epochenübergreifende Darstellungen/Geschichtstheorie«
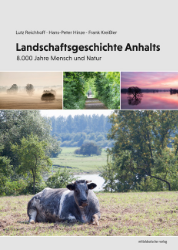
Reichhoff, Lutz/Hans-Peter Hinze/Frank Kreißler
Landschaftsgeschichte Anhalts
8.000 Jahre Mensch und Natur
Landschaftsgeschichte Anhalts
8.000 Jahre Mensch und Natur
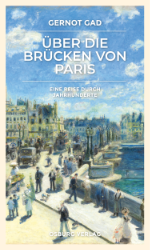
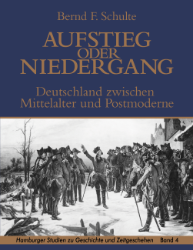
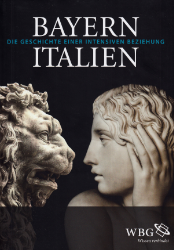

Goten, Angela van der
Im Gespaltenen Zauberland
Oswald Spengler und die Aneignung des Fremden. Versuch einer interdisziplinären …
Im Gespaltenen Zauberland
Oswald Spengler und die Aneignung des Fremden. Versuch einer interdisziplinären …

Historische Kulturlandschaft Rhön. Band 4
Band 4: Historische Kulturlandschaft der Südrhön mit den Schwarzen Bergen
Band 4: Historische Kulturlandschaft der Südrhön mit den Schwarzen Bergen