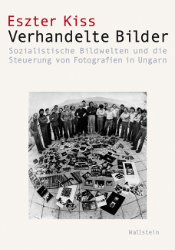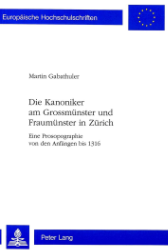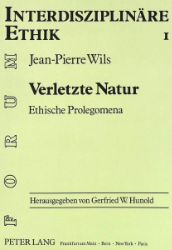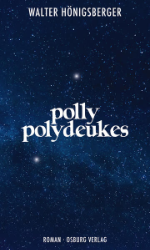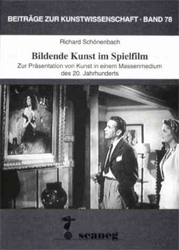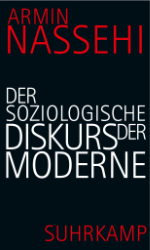Hölscher, Lucian: Zeitgärten
Zeitfiguren in der Geschichte der Neuzeit. Kann es eine »Theorie historischer Zeiten« geben? Mit dem Ansatz der "Zeitfiguren" versucht Lucian Hölscher eine Antwort. Er beschreibt, inwiefern die Zeit in der Geschichte nicht einfach von früher nach später verläuft, sondern in Figuren, die sich in den Zeitgärten der Geschichtsschreibung zu Ornamenten und Abteilungen ordnen. Zunächst bestimmt Hölscher die beiden Sorten der "leeren" und der "gefüllten" Zeit und stellt deren Implementierung durch Historiker wie Gatterer, Schlözer und Schiller dar. Im Anschluss zeigt er anhand von 24 Beispielen, die von Schlözer bis Steinmetz reichen, die Vielfalt der Verwendungen von Zeitfiguren. Auf dieser Grundlage entwickelt Hölscher schließlich seinen eigenen zeittheoretischen Ansatz. - Kann es eine »Theorie historischer Zeiten« (Fernand Braudel und Reinhart Koselleck) geben? Mit seinem Baukasten der Zeitfiguren untersucht Lucian Hölscher die Idee der 'Zeitfigur' daraufhin, ob sie als Grundlage einer »Theorie historischer Zeiten« dienen kann. Ausgewählte Beispiele der neuzeitlichen Geschichtsschreibung dienen als Grundlage, um die Fragestellung einzugrenzen. Die Wahl des Titels 'Zeitgärten' verweist dabei auf die Ausgangshypothese, dass der Geschichte, trotz aller konstruktivistischen Kritik an ihrem metaphysischen Begriff zur Zeit der Aufklärung, jeweils eine einheitliche Wirklichkeitskonzeption zugrunde liegt. - Die Zeit verläuft in der Geschichte nicht einfach von früher nach später, sondern in Figuren: bald als Fortschritt, bald als Epochensprung, bald geschichtet nach unterschiedlichen Geschwindigkeiten. In den hier vorgestellten Geschichtswerken verknüpfen sie sich zu Zeitgärten, deren Anlage sich im Laufe der Zeit verändert hat. In den Zeitgärten der Geschichtsschreibung ordnen sich die Zeitfiguren der Geschichte zu Ornamenten und Abteilungen. Es ist die Leere der Zeit, die diesen Formenreichtum des Lebens ermöglicht und steuert. In ihr findet die Vielfalt der Zeiten, die das geschichtliche Leben hervorbringt, ihren gemeinsamen Grund. Nach einer Darstellung der temporalen Grundbausteine historischer Erzählungen (Zeitbegriffe), die zum größten Teil erst im Laufe des 18. Jahrhunderts entstanden sind, werden im zweiten Kapitel prominente historische Werke porträtiert, die bis in die Gegenwart reichen (von August Ludwig Schlözer, Johann Wilhelm Archenholz, Friedrich Schiller, Friedrich Wilhelm Schlosser, Wolfgang Menzel, Johann Gustav Droysen, Leopold von Ranke, Georg Gottfried Gervinus, Gustav Freytag, Edward Bellamy, Heinrich von Treitschke, Friedrich Meinecke, Lucien Febvre, Golo Mann, Reinhart Koselleck, Carlo Ginzburg, Thomas Nipperdey, Reinhard Rürup, Hans-Ulrich Wehler, Eric Hobsbawm, Mark Mazower, Jürgen Kocka, Ulrich Herbert und Willibald Steinmetz). Diese Porträtgalerie will an konkreten Beispielen die historiographische Praxis untersuchen und in deren Wandel die temporalen Figuren herausfinden, mit denen Historiker jeweils gearbeitet haben. Schließlich werden im dritten Kapitel die Zeitfiguren gesammelt und systematisch entfaltet, bevor abschließend die Frage nach dem Raum, in dem sich die historischen Zeitfiguren begegnen, und nach dem Charakter der »Leere« erörtert werden, der die historische Zeit als universalistisches Konzept kennzeichnet. Er könnte eine Antwort auf den viel zitierten Ruf nach einer »Theorie historischer Zeiten« geben, der vor einem halben Jahrhundert von den großen Historikern Fernand Braudel und Reinhart Koselleck erhoben worden ist. 325 Seiten mit 11 Abb., gebunden (Wallstein Verlag 2020) leichte Lagerspuren