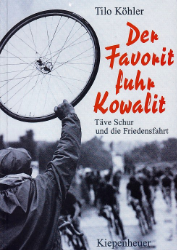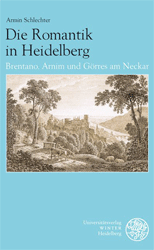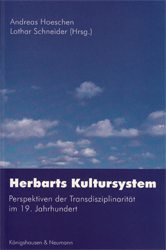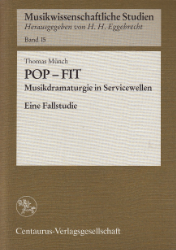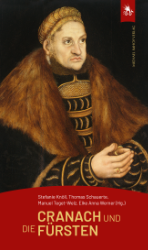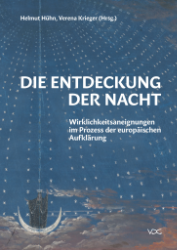Golab, Jakob: Hollandismus als Methode der treuen Naturnachahmung
Rezeption der niederländischen Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts im französischen Kunstdiskurs des Spätbarock und der Aufklärung. Insbesondere im Kontext der Landschaftsmalerei brachte der Einfluss niederländischer Malerei des 17. Jahrhunderts eine neue Art der Naturbetrachtung hervor. Wie kam es dazu? Am Beispiel des französischen Kunstdiskurses zeigt die Studie Kontinuitäten und Brüche. - Insbesondere im Kontext der Landschaftsmalerei des 18. Jahrhunderts spricht man von "Hollandismus", um den großen Einfluss niederländischer Malerei des 17. Jahrhunderts auf das folgende Kunstschaffen begrifflich fassen zu können. Dennoch ist dieses Phänomen wissenschaftlich weder zureichend charakterisiert noch je umfassend aufgearbeitet worden. Es ist bisher nicht klar, wie Kunsttheorie und Kunstproduktion, Kunstkritik und Kunstmarkt zusammenwirkten und einen Geschmackswandel herbeiführten, der wiederum eine neue Art der Naturbetrachtung hervorbrachte. Die Studie stellt nicht nur die Einzelaspekte zu einem Gesamtüberblick zusammen, sondern bietet darüber hinaus neue Sichtweisen. Sie füllt eine Forschungslücke, indem sie am Beispiel des französischen Kunstdiskurses das Phänomen des Hollandismus neu und umfassend beleuchtet. Die Untersuchung schreitet die Stationen der Landschaftsmalerei im Lauf des 18. Jahrhunderts ab, in der Hoffnung, so die Verbindungslinien, Konstanten und mögliche Brüche innerhalb des Kunstdiskurses offenzulegen. "Die Dimensionen der Aufgabe, ein ganzes Jahrhundert im Detail zu betrachten, erzwingen eine räumliche Eingrenzung. Da Frankreich im 18. Jh. als die nordalpine Kunstnation von buchstäblich maßgeblichem internationalen Einfluss galt, liegt es nahe, den dortigen Kunstdiskurs anzuvisieren. [...] Ausgehend von der Vorstellung, der Kunstdiskurs sei nur ein Subsystem neben weiteren, die zusammen das System Gesellschaft sind und zwangsläufig interaktiv aufeinander einwirken, scheint es zweckmäßig, auch Prozesse in anderen Subsystemen zu betrachten, um ihre mögliche Rolle als Impulsgeber oder Antriebskräfte des Wandels innerhalb des Kunstdiskurses auszumachen. Deshalb wird insbesondere ein Seitenblick geworfen werden auf den philosophischen Begriffs- und Gewichtungswandel in Ontologie und Erkenntnistheorie sowie auf ökonomische Theorien der Zeit und ihre praktischen Auswirkungen in der Landwirtschaft, außerdem schließlich auf den Wandel literarischer Darstellungsformen der Natur und des Landlebens" (aus der Einleitung). 335 Seiten, gebunden (VDG Weimar - Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften 2018)