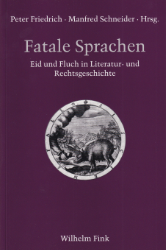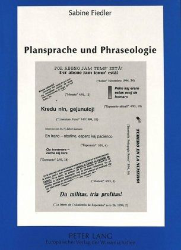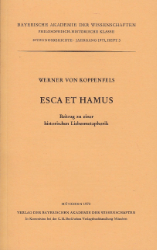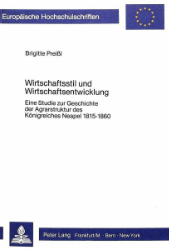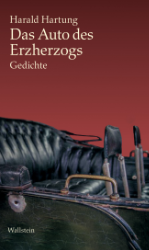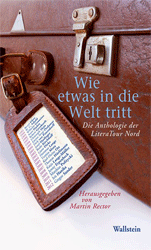Krankheit schreiben
Aufzeichnungsverfahren in Medizin und Literatur. Hrsg. von Yvonne Wübben und Carsten Zelle. 18 Beiträge widmen sich der Wechselwirkung von medizinischen Aufzeichnungsverfahren und literarischen Formen, gegliedert in die zwei Themenbereiche I. Aufzeichnen in Pathologie, Psychiatrie und Literatur; II. Medizinische und literarische Schreibweisen. Die Autorinnen und Autoren untersuchen medizinische Aufzeichnungsverfahren aus literatur- und wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart und fragen nach ihrer Bedeutung für Datenerfassung und Krankheitslehre. Sie fragen insbesondere, inwiefern verschiedene Schreibverfahren das Aufgezeichnete mitbestimmen und welcher Zusammenhang zwischen Schreibverfahren und der Konjunktur bestimmter Pathologien besteht. Ärzte verbringen ihre Tage oft schreibend: Sie protokollieren, notieren und tragen in Formulare ein. Krankheit ist so wesentlich im Raum der Schrift situiert. Von dieser Beobachtung ausgehend, fragen die Autorinnen und Autoren danach, inwiefern verschiedene Schreibverfahren das Aufgezeichnete mitbestimmen. Wie stellt sich der Zusammenhang zwischen diesen Schreibverfahren und der Konjunktur bestimmter Pathologien dar? In welchem Verhältnis stehen Literatur und Medizin dabei? Gibt es eine nachhaltige Präsenz von literarischen Formen in der Medizin bis in die Moderne? Wie nimmt die Literatur Elemente medizinischer und wissenschaftlicher Genres auf und wie transformiert sie sie zu eigenen Schreibweisen? - Aus dem Inhalt: Yvonne Wübben: Aufzeichnen in Pathologie, Psychiatrie und Literatur: Einleitung. - Gianna Pomata: Fälle mitteilen. Die "Observationes" in der Medizin der Frühen Neuzeit. - Christoph Hoffmann: Eine Papierleiche: Autopsiebericht 838/83. - Sophie Ledebur: Sehend schreiben, schreibend sehen. Vom Aufzeichnen psychischer Phänomene in der Psychiatrie. - Maike Rotzoll: Krankheit schreiben in der Psychiatrie um 1900? Diagnosen, Kranken- und Patientengeschichten von Opfern der nationalsozialistischen »Euthanasie«-Aktion »T4«. - Hubert Thüring: Die Aktenlogik von Polizei, Justiz, Psychiatrie bei Friedrich Glauser und Adolf Wölfli. - Yvonne Wübben: Mikrotom der Klinik. Der Aufstieg des Lehrbuchs in der Psychiatrie (um 1890). - Georg Juckel: Aufschreibeprozesse in Psychiatrie und Psychotherapie. - Andreas Mayer: Gehen, Denken, Schreiben. Balzacs Psychopathologie der Gangarten. - Stephan Kammer: Autographien der Krankheit. Physiologie und Pathologie der Handschrift um 1900. - Cornelia Ortlieb: Hirnpalimpseste. Rauschphantasien und andere Schreib-Krankheiten von De Quincey bis Bernhard. - Carsten Zelle: Medizinische und literarische Schreibweisen: Einleitung. - Armin Schäfer: Das psychiatrische Gutachten um 1900. - Michael Niehaus: Krankheit umschreiben. Protokoll eines Inquisitionsverfahrens. - Reinhold F. Glei: Krankheit dichten. Kranker Mensch und kranke Natur im lateinischen Lehrgedicht. - Carsten Zelle: Fall und Fallerzählungen in Friedrich Hoffmanns "Medicina Consultatoria" (1721-1739). - Maximilian Bergengruen: Herkunft als Bedrohung. Verfolgungswahn und Vererbung in Ludwig Tiecks "Der blonde Eckbert". - Stefan Goldmann: Kasus und Konflikt. Zur Wechselbeziehung zwischen Krankengeschichte und Novelle mit einem Blick auf Johann Ludwig Caspers "Klinische Novellen" (1863). Ein Werkstattbericht. - Rudolf Behrens/Marie Guthmüller: Krankes/gesundes Leben schreiben. Emile Zolas "Le docteur Pascal" im Umgang mit dem Hereditäts- und Lebenswissen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. - Nicolas Pethes: Fall, Fälle, Zerfall. Zur medizinischen Schreibweise in Thomas Bernhards Romanen "Frost" und "Verstörung" (mit einem Exkurs zu Adalbert Stifters "Die Mappe meines Urgroßvaters"). - 487 Seiten mit 17 Abb., gebunden (Wallstein Verlag 2013) leichte Lagerspuren