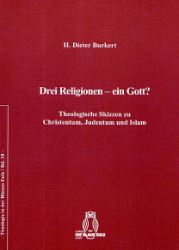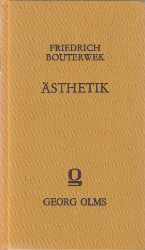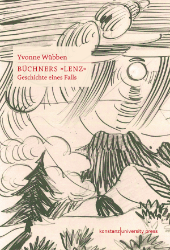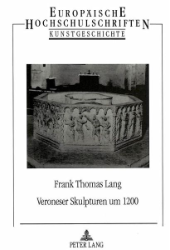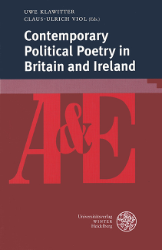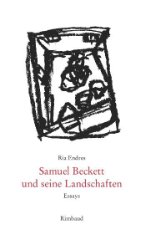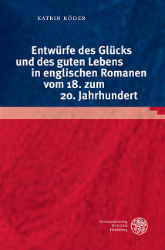
Röder, Katrin: Entwürfe des Glücks und des guten Lebens in englischen Romanen vom 18. zum 20. Jahrhundert
Katrin Röder analysiert literarische Darstellungen von Glück und dem guten Leben aus den Perspektiven der Ethik und Hermeneutik der Existenz, insbesondere am Beispiel ausgewählter Werke von Daniel Dafoe, Samuel Johnson, Charlotte Brontë, Virginia Woolf und Salman Rushdie. Untersucht werden die Verhandlung unterschiedlicher Diskurse und Konzeptionen von Glück und dem guten Leben (v.a. des utilitaristischen Glücksstrebens, der Selbstsorge und der Eudämonie, aber auch religiöser, spiritueller und folkloristischer Konzeptionen von Glück) in englischen Romanen im Kontext von Geschlechterdifferenz und Postkolonialismus. Glück erscheint hierbei nicht als feststehende Konzeption, vielmehr basiert seine Darstellung auf hermeneutischen Praktiken des Erzählens, Deutens und Bewertens von Lebensgeschichten, die kontingente Sinnzusammenhänge zwischen Ereignissen der Handlung sowie vorläufige, kontingente Bewertungen von Ereignissen, Erfahrungen, Lebensweisen, Bedürfnissen, Weltanschauungen und gesellschaftlichen Strukturen erzeugen und Leser zur eigenen Bewertung und Deutung literarischer Lebensgeschichten anregen. In den sieben Kapiteln werden Darstellungen unterschiedlicher Glückskonzeptionen und subjektiver Erfahrungen von Glück am Beispiel ausgewählter Romane untersucht, die klassen-, geschlechts- und kulturspezifische Aneignungen, Umwertungen und Neubestimmungen westlicher, aber auch interkultureller Konzeptionen von Glück zum Gegenstand haben. Ein besonderer Schwerpunkt der Textanalyse liegt bei der Untersuchung hermeneutischer Prozesse, die der erzählerischen Darstellung von Glück und ihrer Rezeption zugrunde liegen. Untersucht wird: Utilitaristisches Glücksstreben und religiöse Askese in Daniel Defoes Crusoe-Romanen; die Wahl des guten Lebens in Samuel Johnsons "Rasselas"; Alternative Formen von Glück in Charlotte Brontës "Jane Eyre"; Neue Formen des guten Lebens in Virginia Woolfs "The Years" und die Ethik der kulturellen Hybridität in Salman Rushdies "The Satanic Verses". 277 Seiten, gebunden (Anglistische Forschungen; Band 452/Universitätsverlag Winter 2015)