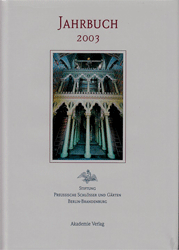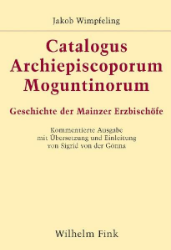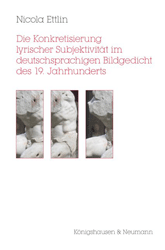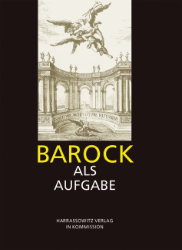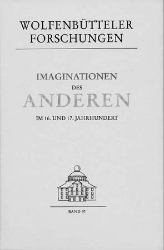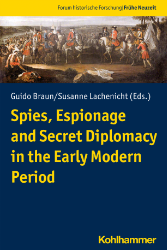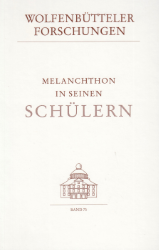Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
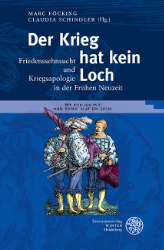
Der Krieg hat kein Loch
Friedenssehnsucht und Kriegsapologie in der Frühen Neuzeit. Hrsg. [und mit einem Vorwort] von Marc Föcking und Claudia Schindler.Veränderte ideologische, soziale, technische und kulturelle Bedingungen führen in der Frühen Neuzeit zu einer spezifischen, sich selbst reproduzierenden Bellizität. Neun Beiträge fragen nach den neuen Strategien der Legitimation wie der Delegitimierung des Krieges in den Literaturen dieser Zeit. Der Band gliedert sich in die Abschnitte: I. Vorwort. - II. Frieden schaffen - mit Waffen? Friedenskonzepte, Friedenstheologie und Friedensethik im 15. und 16. Jahrhundert. - III. Fiktive und faktuale Schlachten. Literarische Strategien der Kriegsdarstellung. - IV. Trauma und Trost. Literarische Wundversorgungen. - Coda: Krieg im Bett. Kriegsmetaphorik, Liebeslyrik und die Überwindung des Krieges. - Die Frühe Neuzeit in Europa gilt als ein besonders kriegerisches Zeitalter. Sie ist zwar insgesamt nicht kriegerischer als das Mittelalter, doch verändern sich in ihr die ideologischen, sozialen, technischen und kulturellen Bedingungen des Krieges: Die Legitimationen der Kriege in der Frühen Neuzeit werden zunehmend arbiträr, gleichzeitig zerfallen in Zeiten neuer Waffentechniken und auf Mietbasis operierender Söldnerheere alte ständische Hierarchien und Verhaltens-Codices. Diese sich selbst reproduzierende Bellizität fordert in den Literaturen der Frühen Neuzeit neue Strategien der Legitimation wie der Delegitimierung des Krieges, denen die Beiträge dieses Bandes nachgehen. Die neun Beiträge dieses Bandes versuchen zu zeigen, dass die Literatur des 15., 16. und 17. Jahrhunderts sich nicht auf eine einlinige Stützung der Legitimierung kriegsführender Mächte, Reiche, Religionen oder Konfessionen beschränken lässt, sondern vielmehr ein ebenso legitimierendes wie delegitimierendes, vielstimmiges Diskussionsfeld eröffnet und dieses mit den alles andere als monolithischen Herrscher- und Kriegsapologien propagierenden literarischen Gattungen wie der Predigt- und Erbauungsliteratur, des Dialogs, des poema cavalleresco, des (Bürgerkriegs-)Epos, des Shakespeare' schen Königsdramas oder der petrarkistischen Liebeslyrik bestellt: So bestreiten humanistische Friedensethiker des 15. Jahrhunderts wie auch Luther als erster protestantischer Theologe die Rechtfertigung des Krieges als Mittel weltlicher wie religiöser Herrschaftssicherung, literarische Schlachtendarstellungen profilieren nostalgisch die untergegangenen Rittertugenden gegen die mörderische Technisierung des Krieges durch Feuerwaffen und Militärtechnik der Gegenwart; oder sie changieren, wie bei Shakespeare, zwischen heroisch patriotischer Rhetorik des Herrschers und implizierter Fragwürdigkeit der Kriegsgründe. Die Schrecknisse frühneuzeitlicher Schlachtfelder und Gewalttaten der Konfessionskriege treten in ihren traumatisierenden Wirkungen in aller Dringlichkeit in der Literatur eines Agrippa d'Aubigné hervor und fordern eine ebenso theologische wie psychische Nachsorge, so in einer frühen Form von Militärseelsorge. Die Friedenssehnsucht angesichts des unbeherrschbaren und ubiquitären Kriegsgeschehens verleiht schließlich auch dem seit der Antike virulenten Topos des Liebeskrieges in der Liebeslyrik zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges eine neue Dringlichkeit und zeitkritische Aktualität. - Aus dem Inhalt: Jürgen Sarnowsky: Friedensvorstellungen in der Zeit Papst Pauls I. - Jens Wolff: Krieg und Frieden. Deutungsmachtkonflikte nach Martin Luther. - Tilo Renz: Die Außenkontakte einer anderen Welt. Krieg, Hegemonie und Kulturtransfer in Thomas Morus' Utopia. - Marc Föcking: Ariost und die Bombe. Rittertugend versus Militärtechnik im 'Orlando Furioso'. - Claudia Schindler: "Barbarico tingi sanguine vidit aquas". Die Schlacht von Lepanto in der neulateinischen Dichtung. - Ralf Hertel: Kriegsstück oder Antikriegsstück? Von der Subjektivierung des Krieges in Shakespeares Heinrich V. - Silke Segler-Meßner: Mord und Martyrium. Die Religionskriege als Trauma der französischen Erinnerungskultur. - Johann Anselm Steiger: Gerechter Krieg und ewiger Friede. Zu Theologie und Ethik lutherischer Konsolationsliteratur für Soldaten zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. - Harry Fröhlich: "damit die böse Zeit nun würde hingebracht." Liebestopik und Kriegserfahrung bei Martin Opitz. - 239 Seiten, gebunden (Beihefte zur Germanisch-Romanischen Monatsschrift; Heft 65/Universitätsverlag Winter 2014) leicht angeschmutzt
Bestell-Nr.: 14697
ISBN-13: 9783825362041
ISBN-10: 3825362043
Erscheinungsjahr: 2014
ISBN-13: 9783825362041
ISBN-10: 3825362043
Erscheinungsjahr: 2014
Reihe: Beihefte zur Germanisch-Romanischen Monatsschrift
Herausgeber*innen: Claudia Schindler, Marc Föcking
Sprache: Deutsch
Zustand: Wie neu, leicht angeschmutzt
Herausgeber*innen: Claudia Schindler, Marc Föcking
Sprache: Deutsch
Zustand: Wie neu, leicht angeschmutzt
Weitere Bücher der Reihe »Beihefte zur Germanisch-Romanischen Monatsschrift«




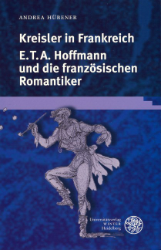
Hübener, Andrea
Kreisler in Frankreich
E.T.A. Hoffmann und die französischen Romantiker (Gautier, Nerval, Balzac, …
Kreisler in Frankreich
E.T.A. Hoffmann und die französischen Romantiker (Gautier, Nerval, Balzac, …
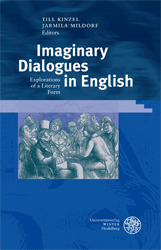
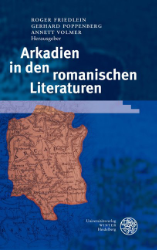
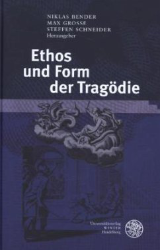
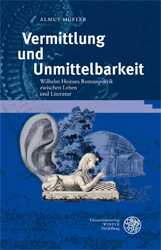
Hüfler, Almut
Vermittlung und Unmittelbarkeit
Wilhelm Heinses Romanpoetik zwischen Leben und Literatur
Vermittlung und Unmittelbarkeit
Wilhelm Heinses Romanpoetik zwischen Leben und Literatur
Weitere Bücher im Sachgebiet »Geschichte der Frühen Neuzeit«
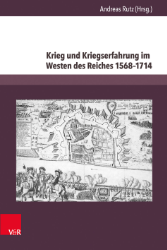
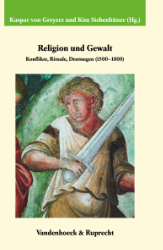

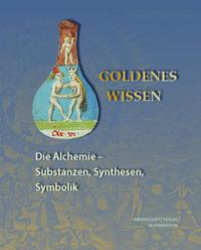
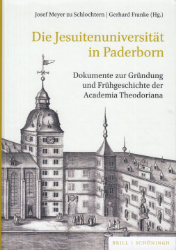
Die Jesuitenuniversität in Paderborn
Dokumente zur Gründung und der FrühgeschichteAcademia Theodoriana
Dokumente zur Gründung und der FrühgeschichteAcademia Theodoriana