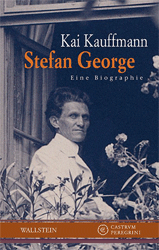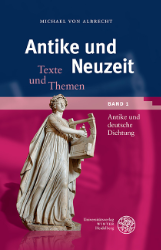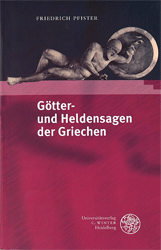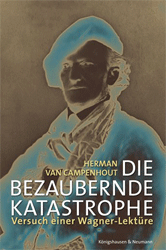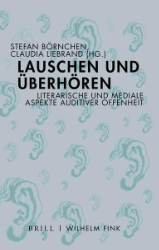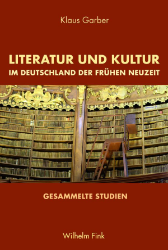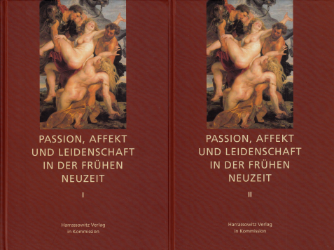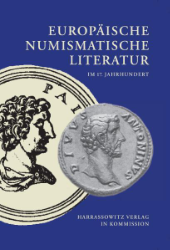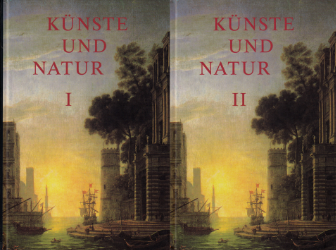Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.

Barocke Bildkulturen
Dialog der Künste in Giovan Battista Marinos "Galeria". Hrsg. [und mit einer Einführung] von Rainer Stillers und Christiane Kruse.'La Galeria' (1619) gilt als der erste neuzeitliche Dichtungszyklus über Werke der bildenden Kunst und erfreute sich großer Beliebtheit und Verbreitung. 15 Beiträge (zwei davon italienisch) zeigen aus Sicht unterschiedlicher Disziplinen die Aktualität, die das Werk im Kontext der gegenwärtigen Bild-Text-Diskussion gewinnt. Der Band, der auf die gleichnamige Tagung 2006 an der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel zurückgeht, gliedert sich in drei Themenfelder: I. Historische und poetologische Grundlagen; II. Bildbetrachtung und Bilderleben; III. Dialoge von Texten und Bildern. - Auf der Tagung bildete die 'Galeria' das Zentrum eines intensiven Gesprächs zwischen Kunst- und Literaturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern. Die hier versammelten Beiträge fixieren einen interdiziplinären Dialog, der die Komplementarität von Texten und Bildern in einer spezifisch barocken Bildkultur sichtbar machen will. Im interdisziplinären Zugang von Literatur- und Kunstwissenschaft werden über den hinlänglich diskutierten "paragone" hinaus insbesondere der zum Verständnis barocker Kunst spezifische bild- und rezeptionstheoretische Gehalt der 'Galeria' erschlossen. Das neue Erkenntnisinteresse an der barocken Bildkultur erfordert einen bildwissenschaftlichen und kulturanthropologischen Zugang, den Marinos Text im Dialog mit den in ihm rezipierten bzw. fingierten Kunstwerken wie kein zweiter eröffnet. Die Schnittstellen dieses Dialogs sind die Bilder und der Mensch als Bilder rezipierendes Subjekt. Die imaginierten Bilder und ihr doppelter Bezug zur Medialität, den die 'Galeria' durchgängig thematisiert, werden an die im Text aufgerufenen (realen oder fingierten) Kunstwerke (Gemälde, Skulpturen usw.) gebunden und im poetischen Text fixiert. Diese doppelte Medialität der Bilder ist die Voraussetzung für das neue Potenzial barocker Bildlichkeit, das dem Rezipienten das Kunstwerk mit seiner ganzen Leistungsfähigkeit über den lyrischen Text nicht nur visuell-imaginativ, sondern auch emotional-körperlich erschließt. Die kulturanthropologische Bedeutung des Textes liegt somit in der Zentralstellung des Subjekts, das über den Rezeptionsprozess von Werken der bildenden Kunst die machtvolle Wirkung der Bilder erfährt. - Aus dem Inhalt: Christiane Kruse/Rainer Stillers: Einführung. - Victoria von Flemming: Was ist ein Bild? Marinos "Dicerie sacre". - Barbara Marx: Sammeln und Schreiben. Zur Konstitution der "Galeria" von Giambattista Marino. - Giovanna Rizzarelli: Descrizione dell'arte e arte della descrizione nelle "Lettere" e nella "Galeria" di Giovan Battista Marino. - Christine Ott: Pfeile ohne Ziel? Worte, Sachen und Bilder bei Giovan Battista Marino. - Bodo Guthmüller: Poetische Verfahren einer imaginären Vergegenwärtigung von Malerei in Marinos "Favole". - Ingo Herklotz: Marino und die Porträtsammlungen des 16. Jahrhunderts. Skizzen zu einer prosopographisch-rezeptionsgeschichtlichen Untersuchung. - Frank Fehrenbach: "Tra vivo e spento". Marinos lebendige Bilder. - Christiane Kruse: Psychologie einer Bildbetrachtung. Imagination, Affekt und die Rolle der Kunst in "Sopra il ritratto della sua Donna". - Elisabech Oy-Marra: "Immobile riman per meraviglia". Staunen als idealtypische Betrachterreaktion in den Bildgedichten Giovan Battista Marinos zu Tizians hl. Sebastian. - Henry Keazor: "[...] quella miracolosa mano". Zu zwei Madrigalen Marinos auf Ludovico Carracci. - Valeska von Rosen: Caravaggio, Marino und ihre "wahren Regeln". Zum Dialog der Malerei und Literatur um 1600. - Marc Föcking: Bildstörung. Probleme des Ikonischen geistlicher Lyrik in Marinos "La Galeria" und "La Lira". - Ulrich Heinen: "Concettismo" und Bild-Erleben bei Marino und Rubens. Eine medienhistorische Analyse. - Christian Rivoletti: Sulla presenza di Ariosto e di altri modelli letterari e figurativi nella "Galeria" di Giovan Battista Marino. - Ulrich Pfisterer: Iconologia Mariniana. Marinos Selbst- und Fremdbilder. 448 Seiten mit 35 Textabb. und 8 Farbtafeln, gebunden (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung; Band 48/Herzog August Bibliothek in Kommission bei Harrassowitz Verlag 2013)
Bestell-Nr.: 15274
ISBN-13: 9783447066280
ISBN-10: 3447066288
Erscheinungsjahr: 2013
ISBN-13: 9783447066280
ISBN-10: 3447066288
Erscheinungsjahr: 2013
Bindungsart: gebunden
Umfang: 448 Seiten mit 35 Textabb. und 8 Farbtafeln
Gewicht: 1,20 kg
Verlage: Herzog August Bibliothek, Harrassowitz Verlag
Umfang: 448 Seiten mit 35 Textabb. und 8 Farbtafeln
Gewicht: 1,20 kg
Verlage: Herzog August Bibliothek, Harrassowitz Verlag
Reihe: Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung
Herausgeber*innen: Rainer Stillers, Christiane Kruse
Sprachen: Deutsch, Italienisch
Zustand: Neu
Herausgeber*innen: Rainer Stillers, Christiane Kruse
Sprachen: Deutsch, Italienisch
Zustand: Neu
Weitere Bücher der Reihe »Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung«
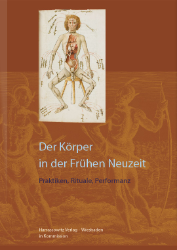
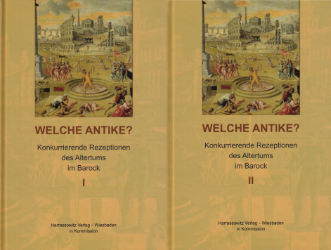
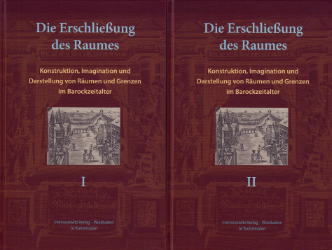
Die Erschließung des Raumes
Konstruktion, Imagination und Darstellung von Räumen und Grenzen im Barockzeitalter …
Konstruktion, Imagination und Darstellung von Räumen und Grenzen im Barockzeitalter …
Weitere Bücher im Sachgebiet »Neuere italienische Literatur«

Heitmann, Klaus
Das italienische Deutschlandbild in seiner Geschichte. Band III.2
Band III: Das kurze zwanzigste Jahrhundert (1914-1989); Teil 2: Zeitzeugen der …
Das italienische Deutschlandbild in seiner Geschichte. Band III.2
Band III: Das kurze zwanzigste Jahrhundert (1914-1989); Teil 2: Zeitzeugen der …

Heitmann, Klaus
Das italienische Deutschlandbild in seiner Geschichte
Band 1: Von den Anfängen bis 1800. Band 2: Das lange neunzehnte Jahrhundert …
Das italienische Deutschlandbild in seiner Geschichte
Band 1: Von den Anfängen bis 1800. Band 2: Das lange neunzehnte Jahrhundert …
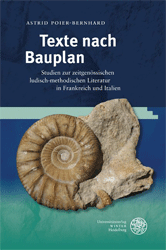
Poier-Bernhard, Astrid
Texte nach Bauplan
Studien zur zeitgenössischen ludisch-methodischen Literatur in Frankreich und …
Texte nach Bauplan
Studien zur zeitgenössischen ludisch-methodischen Literatur in Frankreich und …
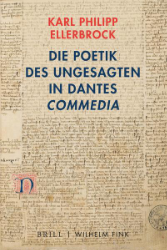

Feddern, Stefan
Dichtung als Wissenschaft und Unterrichtsgegenstand
Zur Poetik im frühen italienischen Humanismus (von Petrarca bis Battista Guarino) …
Dichtung als Wissenschaft und Unterrichtsgegenstand
Zur Poetik im frühen italienischen Humanismus (von Petrarca bis Battista Guarino) …

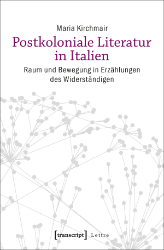
Kirchmair, Maria
Postkoloniale Literatur in Italien
Raum und Bewegung in Erzählungen des Widerständigen
Postkoloniale Literatur in Italien
Raum und Bewegung in Erzählungen des Widerständigen
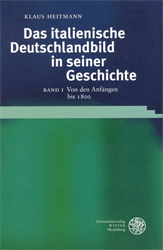
Heitmann, Klaus
Das italienische Deutschlandbild in seiner Geschichte. Band I
Band I: Von den Anfängen bis 1800
Das italienische Deutschlandbild in seiner Geschichte. Band I
Band I: Von den Anfängen bis 1800
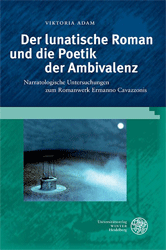
Adam, Viktoria
Der lunatische Roman und die Poetik der Ambivalenz
Narratologische Untersuchungen zum Romanwerk Ermanno Cavazzonis
Der lunatische Roman und die Poetik der Ambivalenz
Narratologische Untersuchungen zum Romanwerk Ermanno Cavazzonis