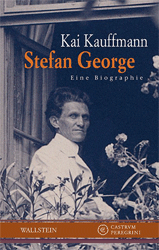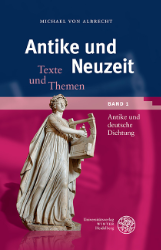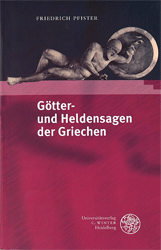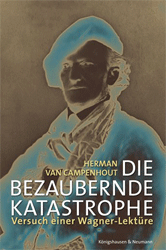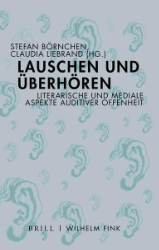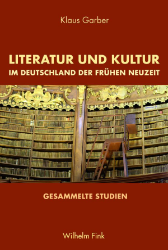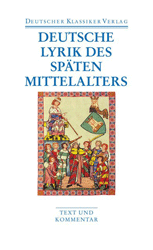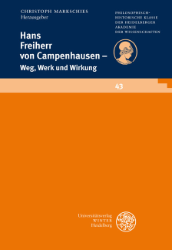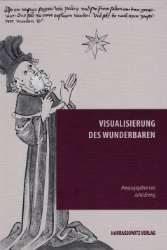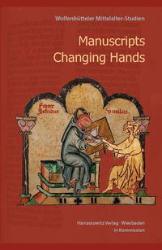Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.

Wachinger, Burghart
Erzählen für die Gesundheit
Diätetik und Literatur im Mittelalter. Vorgetragen am 25. November 2000. Spätmittelalterliche Gesundheitslehren fügen in ihre Informationen über Speisen und Getränke, Schlaf und Schlaflosigkeit usw. gelegentlich auch den Hinweis ein, dass Erzählungen die Gesundheit von Leib und Seele fördern können. Literaten haben diesen medizinisch-diätetischen Topos benutzt, um insbesondere solche Literatur zu legitimieren, die vor geistlich-moralischen Maßstäben schwer bestehen konnte, d. h. vor allem schwankhaft-anstößige Erzählungen. Im mitteleuropäischen Raum erscheint dieses Begründungsmuster erst wesentlich später als in West- und Südeuropa. Ansätze finden sich immerhin schon zur Zeit der großen Pest im Umkreis Kaiser Karls IV. Um dieselbe Zeit greift in Italien Boccaccio mit der Rahmenerzählung seines 'Dekameron' Empfehlungen der Gesundheitslehren ebenso auf wie die literaturtheoretischen Ansätze zu einer Legitimierung des Witzigen und Gewagten - und reflektiert sie zugleich mit seinen narrativen Mitteln. Die Studie gliedert sich in drei Teile: 1. Die medizinische Tradition; - 2. Zur Aufnahme der diätetischen Empfehlungen im literarischen Diskurs; - 3. Diätetik und Erzählen zu Zeiten der Pest: Boccaccios 'Dekameron'. Die gesundheitsfördernde Wirkung von Literatur war im Spätmittelalter auch von medizinischer Seite anerkannt, freilich weniger zur Heilung somatischer Krankheiten im engeren Sinn als zur vorbeugenden Diätetik und zur Therapie der Melancholie. Der erste Teil dieser Studie handelt deshalb von medizinischen Schriften, die im Rahmen der Diätetik auch der Literatur eine Funktion zuweisen. Der zweite Teil diskutiert, wie weit das Angebot der Diätetik von den mittelalterlichen Literaten aufgegriffen worden ist als Chance, Literatur jenseits der geistlich-moralischen Diskurse zu rechtfertigen. Der dritte Teil zeigt dann, wie ein bedeutender Dichter, Boccaccio, das diätetische Denkmuster aufgegriffen und mit narrativen Mitteln moralphilosophisch durchdrungen hat. 44 Seiten mit 12 Tafeln, broschiert (Schriften der Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften; Band 23/Universitätsverlag Winter 2001)
Bestell-Nr.: 46069
ISBN-13: 9783825312435
ISBN-10: 3825312437
Erscheinungsjahr: 2001
ISBN-13: 9783825312435
ISBN-10: 3825312437
Erscheinungsjahr: 2001
Bindungsart: broschiert
Umfang: 44 Seiten mit 12 Tafeln
Gewicht: 101 g
Verlag: Universitätsverlag Winter
Umfang: 44 Seiten mit 12 Tafeln
Gewicht: 101 g
Verlag: Universitätsverlag Winter
Reihe: Schriften der Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
Autor*in: Burghart Wachinger
Sprache: Deutsch
Zustand: Neu
Autor*in: Burghart Wachinger
Sprache: Deutsch
Zustand: Neu
Weitere Bücher der Reihe »Schriften der Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften«

Strohm, Christoph
Theologenbriefwechsel im Südwesten des Reichs in der Frühen Neuzeit (1550-1620)
Zur Relevanz eines Forschungsvorhabens
Theologenbriefwechsel im Südwesten des Reichs in der Frühen Neuzeit (1550-1620)
Zur Relevanz eines Forschungsvorhabens

Patzold, Steffen
Gefälschtes Recht aus dem Frühmittelalter
Untersuchungen zur Herstellung und Überlieferung der pseudoisidorischen Dekretalen …
Gefälschtes Recht aus dem Frühmittelalter
Untersuchungen zur Herstellung und Überlieferung der pseudoisidorischen Dekretalen …


Smolinsky, Heribert
Deutungen der Zeit im Streit der Konfessionen
Kontroverstheologie, Apokalyptik und Astrologie im 16. Jahrhundert. Vorgetragen …
Deutungen der Zeit im Streit der Konfessionen
Kontroverstheologie, Apokalyptik und Astrologie im 16. Jahrhundert. Vorgetragen …
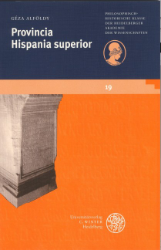

Höfele, Andreas
Zoologie der Tragödie
Von Menschen und Tieren bei Shakespeare. Vorgetragen am 26. Oktober 2002
Zoologie der Tragödie
Von Menschen und Tieren bei Shakespeare. Vorgetragen am 26. Oktober 2002

Hausmann, Frank-Rutger
Die Anfänge der italienischen Literatur aus der Praxis der Religion und des Rechts
Vorgetragen am 10.02.2006
Die Anfänge der italienischen Literatur aus der Praxis der Religion und des Rechts
Vorgetragen am 10.02.2006

Langewiesche, Dieter
Die Monarchie im Jahrhundert Europas
Selbstbehauptung durch Wandel im 19. Jahrhundert. Vorgelegt am 28. Oktober 2006 …
Die Monarchie im Jahrhundert Europas
Selbstbehauptung durch Wandel im 19. Jahrhundert. Vorgelegt am 28. Oktober 2006 …
Weitere Bücher im Sachgebiet »Mediävistik«


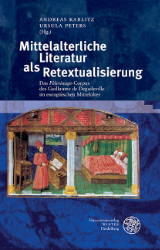
Mittelalterliche Literatur als Retextualisierung
Das 'Pèlerinage'-Corpus des Guillaume de Deguileville im europäischen Mittelalter …
Das 'Pèlerinage'-Corpus des Guillaume de Deguileville im europäischen Mittelalter …
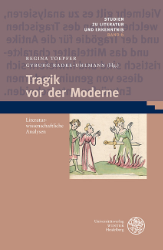

Die religiösen Dichtungen des 11. und 12. Jahrhunderts. Band II
Band II: Die Dichtungen in ungleichzeiligen Langzeilenstrophen
Band II: Die Dichtungen in ungleichzeiligen Langzeilenstrophen

Strittmatter, Ellen
Poetik des Phantasmas
Eine imaginationstheoretische Lektüre der Werke Hartmanns von Aue
Poetik des Phantasmas
Eine imaginationstheoretische Lektüre der Werke Hartmanns von Aue