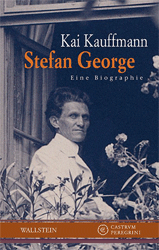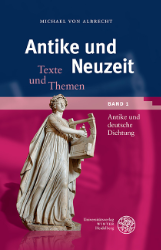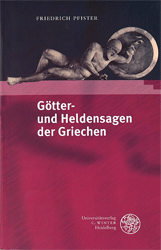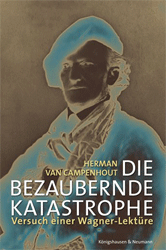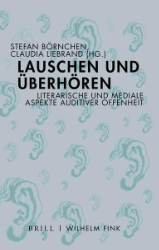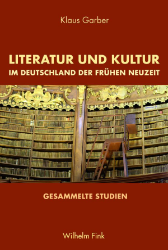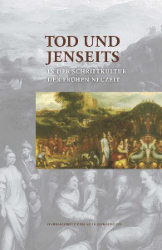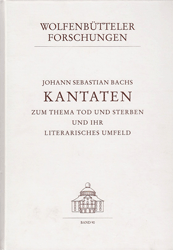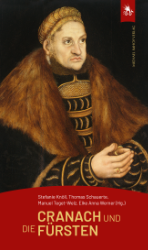Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.

Graphische Porträts in Büchern des 15. bis 19. Jahrhunderts
Hrsg. [und mit einem Vorwort] von Peter Berghaus.Angesichts der kunsthistorischen Vernachlässigung dieses kulturgeschichtlich wichtigen Themas versuchen elf Beiträge, Elemente einer Beschreibung graphischer Porträts im Buch im Wechsel der Jahrhunderte herauszuarbeiten. In seinem einleitenden Beitrag umreißt Bruno Weber die Ausgangsbildende Forschungslage: "Das Porträt im Buch traktieren heißt noch immer Neuland betreten. Es fehlen eine wissenschaftliche Beschreibung der Materie, ein kunsthistorischer Grundriß und ein bibliographisches Kompendium. Die Geschichte der Buchillustration, in der es allenthalben nicht zum Besten bestellt ist, bietet auch hier keine verlässliche Basis". Das graphische Porträt, typischer Ausdruck der technischen Reproduzierbarkeit der Kunst, entwickelte sich, den Gesetzen der jeweiligen Kunststile folgend, von der Renaissance her über Barock, Rokoko und Klassizismus bis zu den Stahl- und Holzstichen des 19. Jahrhunderts mit ihren hohen Auflagen hin. Bedeutende Künstler wie Dürer und Rembrandt standen z. T. hinter manchen dieser Bildnisse, doch ist nicht zu übersehen, dass auch produktive Massenkünstler graphische Porträts minderer Qualität in großer Zahl in den Verkehr brachten. Diese Tatsache mag dazu geführt haben, dass sich Kunsthistoriker kaum dieser kulturgeschichtlich so bedeutsamen Kunstgattung angenommen haben. In Einzelblättern treten schon im 16. Jahrhundert Bildnisbände ganzer Porträtreihen, beginnend mit der Reproduktion der Münzen antiker Herrscher (Andrea Fulvio 1517, Johannes Huttichius 1525, Jacopo de Strada 1553, Hubertus Goltzius 1558), gefolgt von den 'Icones illustrium virorum', die von J. Sambucus (1574), P. Jovius (1577), Christoph Reusner (1587), J. J. Boissard (1597/99), Cornelius Galle (1606) und Anthonis van Dyck (1645) bis zu J. Bruckner (1741/55) reichen. Autorenporträts als Frontispiz begegnen seit dem 16. Jahrhundert und werden im 17./18. Jahrhundert fast zur Regel. Häufig beziehen sie sich in ihrer Darstellung und ihrem Beiwerk auf den Beruf, auf das wissenschaftliche Interesse oder das Studienzimmer des Dargestellten. Zu den Porträts in den Bildniswerken und den Frontispizporträts kommen schon seit dem 16. Jahrhundert die Einzelblattporträts hinzu, die nicht selten auf berühmte Künstler zurückgehen und in ihrem häufig großen Format Spielauf für künstlerische Entfaltung boten. Die Funktionen dieser drei Porträtkategorien sind durchaus verschieden: Das Porträt des Bildnisbandes, dem Who is Who der frühen Neuzeit, nicht selten vom Frontispiz-Porträt oder dem Einzelblatt abgeleitet, soll die berühmte Persönlichkeit - den Fürsten, den Heerführer, den Diplomaten, den Juristen, den Historiker, den Mediziner, den Theologen - auch bildlich bekannt, zugänglich machen. Das Frontispiz-Porträt versucht, eine Beziehung zwischen dem Autor und seinem Werk herzustellen. Dem Einzelblatt-Porträt kommen verschiedenste Funktionen zu: Man hängt es an die Wand, um der verehrten Persönlichkeit nah zu sein, um mit ihr Zwiesprache halten zu können. -- Aus dem Inhalt: Bruno Weber: Vom Sinn und Charakter der Porträts in Druckschriften. - Andreas Wartmann: Drei Porträtwerke aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. - Kirsten Ahrens: Exempla Virtutis. Zum Stellenwert der Devisen im druckgraphischen Herrscherporträt des 17. und frühen 18. Jahrhunderts in Frankreich. - Gregor M. Lechner: Das Prälatenporträt im Schrifttum des 16. bis 18. Jahrhunderts. - Gerd Dethlefs: Friedensboten und Friedensfürsten. Porträtsammelwerke zum Westfälischen Frieden. - Peter Berghaus: Paulus Frehers 'Theatrum Virorum Eruditione Clarorum' (Nürnberg 1688). - Christoph Schreckenberg: Die Gelehrtenbildnisse in Jacob Bruckers und Johann Jacob Haids 'Bilder-sal'. Augsburg 1741-1755. Anmerkungen und Überlegungen. - Alheidis von Rohr: Kostüme im graphischen Bildnis. Realität oder Maskerade? - Cathrin Klingsöhr-Leroy: Reproduktionen von Künstlerbildnissen des 17. Jahrhunderts im 19. Jahrhundert. - Jörg-Ulrich Fechner: "ziemlich verschweizert ... sehr unähnlich und uncharakteristisch"? Zu dem gedruckten Goethe-Porträt von Heinrich Pfenniger. - Thorsten Albrecht: Porträts im Gothaischen Hofkalender. - 217 Seiten mit 201 Abb. auf 68 Tafeln, Großformat, gebunden (Wolfenbütteler Forschungen; Band 63/Herzog August Bibliothek in Kommission bei Harrassowitz Verlag 1995)
Bestell-Nr.: 15427
ISBN-13: 9783447037303
ISBN-10: 344703730X
Erscheinungsjahr: 1995
Format: Großformat
ISBN-13: 9783447037303
ISBN-10: 344703730X
Erscheinungsjahr: 1995
Format: Großformat
Bindungsart: gebunden
Umfang: 217 Seiten mit 201 Abb. auf 68 Tafeln
Gewicht: 896 g
Verlag: Herzog August Bibliothek in Kommission bei Harrassowitz Verlag
Reihe: Wolfenbütteler Forschungen
Umfang: 217 Seiten mit 201 Abb. auf 68 Tafeln
Gewicht: 896 g
Verlag: Herzog August Bibliothek in Kommission bei Harrassowitz Verlag
Reihe: Wolfenbütteler Forschungen
Weitere Bücher der Reihe »Wolfenbütteler Forschungen«
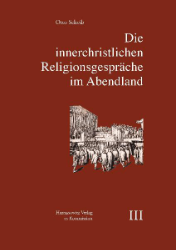
Scheib, Otto
Die innerchristlichen Religionsgespräche im Abendland
Regionale Verbreitung, institutionelle Gestalt, theologische Themen, kirchenpolitische …
Die innerchristlichen Religionsgespräche im Abendland
Regionale Verbreitung, institutionelle Gestalt, theologische Themen, kirchenpolitische …


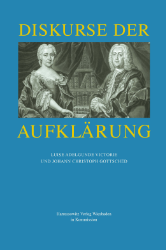
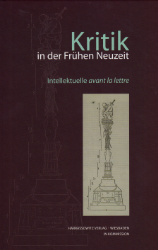
Weitere Bücher im Sachgebiet »Renaissance/Kunst der Frühen Neuzeit«

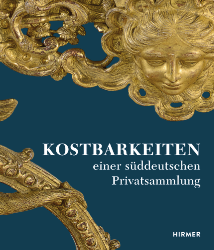

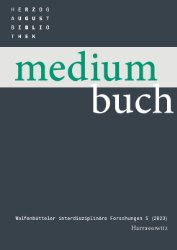
Medium Buch. Band 5 (2023): Inkunabelforschung für morgen - Wege, Ziele, Perspektiven
Tagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte, …
Tagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte, …
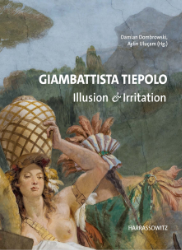
Giambattista Tiepolo. Illusion & Irritation
Beiträge des Internationalen Symposiums im Martin von Wagner Museum der Universität …
Beiträge des Internationalen Symposiums im Martin von Wagner Museum der Universität …

Jagodzinski, Sabine
Das Große Stammbuch Philipp Hainhofers
Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 355 Noviss. 8°. Patrimonia
Das Große Stammbuch Philipp Hainhofers
Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 355 Noviss. 8°. Patrimonia

Grimm, Melanie/Claudia Kleine-Tebbe/Ad Stijnmann
Lichtspiel und Farbenpracht
Entwicklungen des Farbdrucks 1500-1800
Lichtspiel und Farbenpracht
Entwicklungen des Farbdrucks 1500-1800
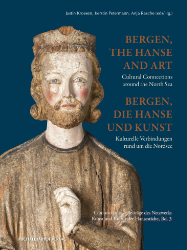
Bergen, die Hanse und Kunst/Bergen, the Hanse and Art
Kulturelle Verbindungen rund um die Nordsee/Cultural Connections around the …
Kulturelle Verbindungen rund um die Nordsee/Cultural Connections around the …