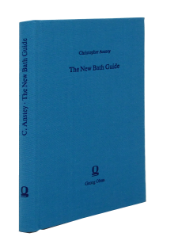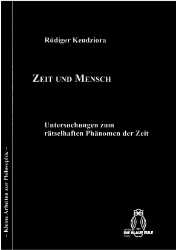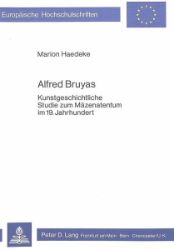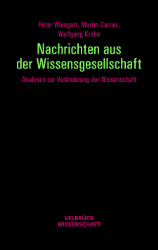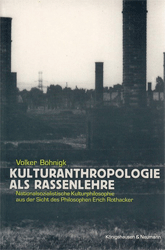Strasser, Gerhard F.: Emblematik und Mnemonik der Frühen Neuzeit im Zusammenspiel: Johannes Buno und Justus Winckelmann
Die Arbeit gibt zunächst einen Überblick über die Ars memorativa-Tradition und untersucht dann - eingeordnet in diesen historischen Rahmen - die aus der Sicht des 17. Jahrhunderts erfolgte Verknüpfung von Elementen der Gedächtniskunst oder Mnemonik mit solchen aus der Emblematik. Darüber hinaus zeigt sie, wie diese Bestandteile um 1650 von den für die Studie wichtigsten Autoren verstanden wurden, insbesondere von Johannes Buno und dessen Marburger Kommilitonen Johann Joachim Winckelmann. Mit ihnen erreichte die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aufblühende späte Mnemonik ihren Höhepunkt. Überraschend ergibt sich für das 20. Jahrhundert in dem emblematisch-mnemonisch vorgehenden Werk des Chemnitzer Lehrers Arno Gürtler ein relevanter Anklang. -- Im ersten Teil der Untersuchung, der einen Überblick über die Ars memorativa-Tradition gibt, spielen die drei klassischen Referenztexte - die damals Cicero zugeschriebene 'Rhetorica ad Herennium', der eigentliche Cicero-Text zur Mnemonik und der des Quintilian - eine grundlegende Rolle. Zu diesem Corpus stoßen im Hoch- und Spätmittelalter weitere Quellen wie etwa die Systeme des Raimundus Lullus. Jedoch erscheinen die maßgebendsten Texte nach 1500 in Italien, werden in der Folge nördlich der Alpen rezipiert und oft auch übersetzt. Autoren wie Ravennatus, Marafiotus, della Porta oder Rossellius, der von Gesualdo erstmals vorgetragene Gedanke, dass Hieroglyphen als Schriftzeichen verwendet werden könnten sowie um die Wende zum 17. Jahrhundert im cisalpinen Bereich Johann Spangenberg, Johannes Austriacus oder Lambert Schen(c)kel beeinflussen mit ihren jeweiligen mnemotechnischen Theorien die Denkweise der zu untersuchenden deutschen Mnemoniker nach 1650. Als weiterer Abschnitt schließt sich ein Überblick über die Entwicklung der Emblemtheorie bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts an, die im deutschen Raum nach etwa 1640 in den Poetikdiskussionen Harsdörffers und anderer zusammen mit Abhandlungen zur Impresentheorie geführt wird. In ähnlichem Zusammenhang ist auch die weiterführende Analyse der in der didaktischen und religiösen Literatur von etwa 1500 bis 1650 immer wichtiger werdenden Illustrationen zu sehen, die eine Sonderstellung innerhalb der Ars memorativa-Tradition einnehmen. Der zweite Teil widmet sich der Analyse der vielen in Königsberg, Danzig und Lüneburg erschienenen einschlägigen Veröffentlichungen des Pädagogen und Theologen Johannes Buno (1617-1697). Im Laufe von über vierzig Jahren entwickelte und verfeinerte er ein erstmals 1913 von Rudolf Windel als "emblematische Methode" bezeichnetes System, das im Kern 1647 in 'Tabularum mnemonicarum historiam universam' erkennbar ist, Bunos erstem Druck. Nach einigen sprachpädagogischen Werken um 1650, in denen Buno mittels "Fabulen und Bildern" den Danziger Schülern deutsche und lateinische Grammatik einprägsam vermitteln wollte, setzt 1672 mit den 'Historischen Bildern' die Weiterentwicklung der emblematischen Methode ein. Erstmals zeigt sich hier eine Verbindung von mnemotechnischem Bildmaterial, um "durch 'imagines' und Bilder dem Gedächtniß gewaltig" zu helfen, mit dem schon 1647 eingeführten "Chronographischen Alphabeth." Endlich ermöglichen klare Anweisungen den Einstieg in die Verbindung von Text und Bild und tragen zur Memorierung im Stil der Ars memorandi bei. Bunos emblematische Methode findet sich in ähnlicher Weise in den 1672 bis 1674 erschienenen drei Digestenbüchern, die einen Teil des 'Corpus iuris civilis' vermitteln wollten. Dank der als "hieroglyphische" an anderer Stelle als "emblematische" Bilder bezeichneten Illustrationen will Buno nun nicht nur wie früher Zahlenmaterial, sondern auch kodifizierte Inhalte dem Gedächtnis anvertrauen. Gleichsam als Krönung seiner Arbeit sind die 1674 mit dem Neuen Testament und 1680 als Gesamtausgabe erschienenen 'Bilder= Bi(e)beln' zu betrachten. Bei dem Marburger Johann Balthasar Schupp hatte auch Johann Justus Winckelmann (1620-1699) studiert, der offenbar wie Buno dessen Ideen zur Mnemonik übernahm und in mehreren Veröffentlichungen vorstellte. Die auf 1648 datierbare, deutsch abgefasste 'Relatio ex Parnasso de Arte Reminiscentiae' legt für spätere Werke theoretische Grundlagen, die sich von Buno unterscheiden und zumindest in diesem Buch mit illustrierbaren Merksätzen als Gedächtnisstütze operieren. Während Winckelmann in seinen ersten Werken eine allgemein gehaltene Diskussion der Mnemonik im weitesten Sinne vornahm, grenzte er die Thematik in den folgenden Veröffentlichungen ein, so in der 'Caesareologia' aus dem Jahre 1659. Hier wird sein mnemonisches System zur Erlernung der Geschichte der römischen Kaiser und ihrer deutschen Nachfolger eingesetzt. Auch Winckelmanns anderes einschlägiges Werk, eine 'Logica memorativa' aus dem Jahre 1658 (mehrmals aufgelegt bis 1728), versucht, das Gebäude der Logik durch Einbindung in erst 1728 klarer gestochenen Merk"tafeln" mnemotechnisch zu stützen. Mit Buno und Winkelmann erreichte die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nochmals aufblühende späte Mnemonik ihren Höhepunkt. Nach diesem Ausklang im Zeitalter des beginnenden pädagogischen Realismus ergibt sich überraschenderweise für das 20. Jahrhundert in dem von 1909 bis 1968 aufgelegten vielfältigen, emblematisch-mnemonisch vorgehenden Werk des Chemnitzer Lehrers Arno Gürtler, das in einer Bearbeitung des Jahres 1952 'Zeichenskizzen zum deutschen Geschichtsunterricht' hieß, ein relevanter Anklang. In diesen für den Lehrer bestimmten Anleitungen lässt sich erneut ein dreiteiliger, emblematisch inspirierter Aufbau sehen, der der besseren Memorierung des im Unterricht an die Tafel zu zeichnenden Materials dienen soll. 154 Seiten mit 41 Abb., Großformat, gebunden (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung; Band 36/Herzog August Bibliothek in Kommission bei Harrassowitz Verlag 2000)