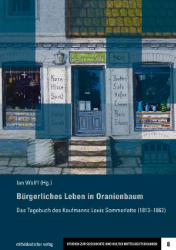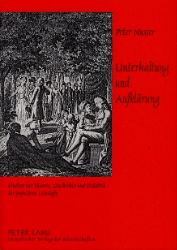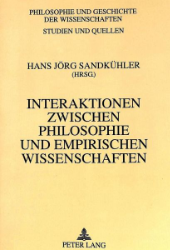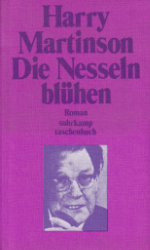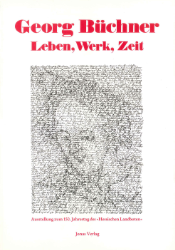Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
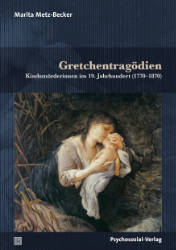
Metz-Becker, Marita
Gretchentragödien
Kindsmörderinnen im 19. Jahrhundert (1770-1870). Goethes Gretchentragödie hat das Bild der Kindsmörderin nachhaltig geprägt. Doch was bedeutete eine ungewollte Schwangerschaft im 18. und 19. Jahrhundert wirklich? In welchem gesellschaftlichen Klima wurden Mütter zu Mörderinnen? Marita Metz-Becker verfolgt die Spuren, die diese Frauen in Akten und Archiven hinterlassen haben. Die Autorin schildert die prekären Lebensumstände der Täterinnen, insbesondere von Dienstmägden, die sich zwischen gesellschaftlicher Ächtung und Scham in einer für sie aussichtslosen Lage wiederfanden. In ihrer kulturwissenschaftlichen Studie untersucht die Autorin den Kindsmord als historisches Phänomen, tief in den Dynamiken und Widersprüchen seiner Zeit verstrickt. Sie fragt, welche Rollen Kirche, Justiz und Medizin im Leben dieser Frauen spielten, das in mehr als 100 Akten des Staatsarchivs Marburg dokumentiert ist. Dabei macht sie Dynamiken von Macht und Ohnmacht sichtbar, die bis in die heutige Zeit fortdauern. - Das Buch richtet seinen Blick auf alltagsweltliche und mentalitätshistorische Zusammenhänge, die Körpererfahrungen der Frauen, die unterschiedlichen Familienkonstellationen, etwa vor dem Hintergrund, dass die ledige Mutter selbst bereits kein familiäres Netz kennengelernt hatte, was als »tradierte Unehelichkeit« gefasst wird. Diese Wahrnehmungen und Erfahrungen der Betroffenen aus ihrer eigenen Sicht zu reflektieren, ihre Alltagswelten anhand mikrohistorisch orientierter Fallgeschichten zu rekonstruieren, um daraus Erklärungsmuster für den Kindsmord abzuleiten, ist von der Forschung bislang nur punktuell geleistet worden. Die Rekonstruktion der Vorstellungen, Wahrnehmungen und Erfahrungen der Täterinnen (und Täter) zeigt das komplexe Bild ihres Alltags, in dem sie durchaus nicht allein standen, sondern in Wechselbeziehung zu Partnern, Nachbarn, Dienstherrschaft, Dienstpersonal, Gesinde und Obrigkeit. Auf Grund von nahezu einhundert überlieferten umfangreichen Prozessakten wird aufgezeigt, wie es zur ungewollten Schwangerschaft kam, wie sie individuell und von der unmittelbaren Umwelt erlebt und gedeutet wurde und wie Macht und Ohnmacht in den alltäglichen Interaktionen zur Verleugnung, Verdrängung und schließlich zur Tat selbst führten. Bei dem Untersuchungsgebiet handelt es sich - territorialgeschichtlich gesehen - zunächst um die Landgrafschaft Hessen-Kassel, dann von 1806 bis 1813 um das Königreich Westphalen und ab 1813 um Kurhessen mit den Kriminalgerichten Marburg, Kassel, Eschwege, Fulda, Hanau, Fritzlar. Die Täterinnen kommen sowohl aus dem ländlichen als auch städtischen Milieu, sie sind lutherischer und reformierter Konfession, etliche unter ihnen auch römisch-katholisch. Ziel des Buches ist es, unter kulturanthropologischen und mentalitätsgeschichtlichen Gesichtspunkten eine Kulturgeschichte des Kindsmords im 19. Jahrhundert vorzulegen. Die Abhandlung über die Kultur- und Mentalitätsgeschichte des Kindsmords im 19. Jahrhundert gliedert sich in neun Kapitel: 1. Einleitung; 2. Kindsmord und Aufklärung; 3. Kindsmord und Recht; 4. Kindsmord und Medizin; 5. Kindsmörderinnen vor Gericht; 6. Die Täterinnen; 7. Orte des Geschehens; 8. Exkurs: Mutterliebe; 9. Prozess und Rechtsprechung. - Neuausgabe [der 1. Auflage von 2016]. 254 Seiten mit 12 Abb., broschiert (Forschung Psychosozial/Psychosozial-Verlag 2021) leichte Lagerspuren
Bestell-Nr.: 86130
ISBN-13: 9783837931013
ISBN-10: 3837931013
Erscheinungsjahr: 2021
Auflage: Neuausgabe [der 1. Auflage von 2016]
ISBN-13: 9783837931013
ISBN-10: 3837931013
Erscheinungsjahr: 2021
Auflage: Neuausgabe [der 1. Auflage von 2016]
Bindungsart: broschiert
Umfang: 254 Seiten mit 12 Abb.
Gewicht: 382 g
Verlag: Psychosozial-Verlag
Reihe: Forschung Psychosozial
Umfang: 254 Seiten mit 12 Abb.
Gewicht: 382 g
Verlag: Psychosozial-Verlag
Reihe: Forschung Psychosozial
Weitere Bücher im Sachgebiet »Geschichte des 19. Jahrhunderts«

Gundlach, Horst
Carl Gustav Jochmann als Söldner, als Testator, als Stifter
Drei Studien zu seinem Leben und Nachleben
Carl Gustav Jochmann als Söldner, als Testator, als Stifter
Drei Studien zu seinem Leben und Nachleben
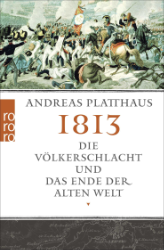
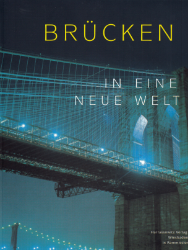
Biegel, Gerd u.a.
Brücken in eine neue Welt
[Softcover-Ausgabe]. Auswanderer aus dem ehemaligen Land Braunschweig
Brücken in eine neue Welt
[Softcover-Ausgabe]. Auswanderer aus dem ehemaligen Land Braunschweig
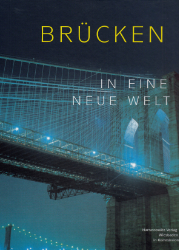
Brücken in eine neue Welt
[Hardcover-Ausgabe]. Auswanderer aus dem ehemaligen Land Braunschweig. Anlässlich …
[Hardcover-Ausgabe]. Auswanderer aus dem ehemaligen Land Braunschweig. Anlässlich …

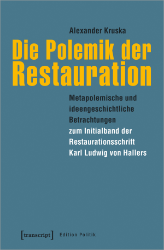
Kruska, Alexander
Die Polemik der Restauration
Metapolemische und ideengeschichtliche Betrachtungen zum Initialband der Restaurationsschrift …
Die Polemik der Restauration
Metapolemische und ideengeschichtliche Betrachtungen zum Initialband der Restaurationsschrift …