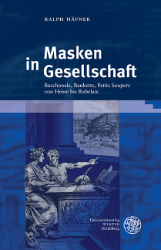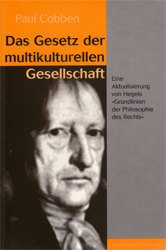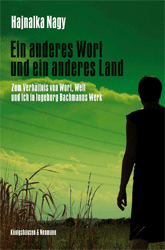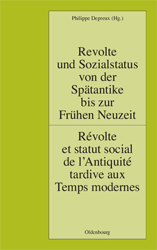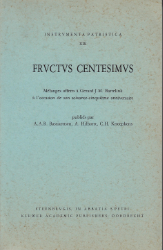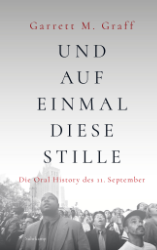Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
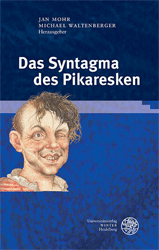
Das Syntagma des Pikaresken
Hrsg. von Jan Mohr und Michael Waltenberger.Zwölf Beiträge nehmen die Prägung pikarischen Erzählens durch spezifisch vormoderne, seriell-episodische Muster und mittelalterliche Biographieschemata und Beglaubigungsmodelle in den Blick. Sie entwickeln interpretative Zugänge zur textuellen und diskursiven Historizität der frühen Pikaroromane, beleuchten deren narrative Verfahren und soziologische Voraussetzungen im spanischen, deutschen und französischen Sprachraum und fragen nach strukturellen Angeboten antiker und mittelalterlicher Erzähltraditionen wie auch nach zeitgenössischen, im intertextuellen Umfeld verfügbaren Optionen. - Das Interesse am Figurentypus des Pícaro richtete sich lange auf die Auseinandersetzung eines Ichs mit der Gesellschaft. Im Antagonismus von neuzeitlichem Bewusstsein und sozialer Umwelt erkannte man ein wandlungsfähiges kulturelles Paradigma, das dem Roman der Moderne wichtige Impulse vermittelt habe. Demgegenüber fand weniger Beachtung, daß die Syntagmen pikarischen Erzählens gleichwohl von spezifisch vormodernen, seriell-episodischen Mustern geprägt sind und sich an mittelalterlichen Biographieschemata und Beglaubigungsmodellen orientieren. Diese Lücke will dieser Band füllen. - Aus dem Inhalt: Caroline Emmelius: Das Ich und seine Geschichte(n). Paradigmatische und syntagmatische Erzählstrukturen in der Novellistik, der mittelalterlichen Ich-Erzählung und im deutschen "Lazaril von Tormes" (1614). - Johannes Klaus Kipf: Episodizität und narrative Makrostruktur. Überlegungen zur Struktur der ältesten deutschen Schelmenromane und einiger Schwankromane. - Magnus Ressel/Cornel Zwierlein: Zur Ausdifferenzierung zwischen Fiktionalitäts- und Faktualitätsvertrag im Umfeld frühneuzeitlichen pikarischen Erzählens. - Franziska Küenzlen: Kommentierung, Übersetzung, Neuschöpfung. Apuleius-Rezeption zwischen wissenschaftlichen und erzählerischen Interessen. - Hans Gerd Rötzer: Geschlossene oder offene Erzählstruktur? Cervantes und die Pikareske. - Robert Folger: Quevedos "Buscón", das nackte Leben und der Grund pikaresken Erzählens im frühneuzeitlichen Spanien. - Jan Mohr: "Buscón" französisch. Zum semantisch-strukturellen Profil der Adaptation durch La Geneste (1633). - Michael Waltenberger: Die Wahrheit im Reich der Thunfische. Zu Struktur und Poetik der anonymen "Lazarillo"-Fortsetzung von 1555. - Matthias Bauer: Das Sagbare umschreiben, am Beispiel des "Guzmán". - Carolin Struwe: Die widerspenstige Feder. Überlegungen zu den drei Erzähleingängen in der "Iustina Dietzin Picara genandt". - Christa M. Haeseli: Die Picara lustina als unzuverlässige Erzählerin? Zur Problematik einer narratologischen Kategorie. - Udo Friedrich: Wahrheit und Wahrscheinlichkeit. Zur Paradigmatik und Syntagmatik des Glücks in Hieronymus Dürers "Lauf der Welt und Spiel des Glücks". 347 Seiten mit 8 Abb., gebunden (Beihefte zur Germanisch-Romanischen Monatsschrift; Heft 58/Universitätsverlag Winter 2014)
Bestell-Nr.: 948234
ISBN-13: 9783825362423
ISBN-10: 3825362426
Erscheinungsjahr: 2014
ISBN-13: 9783825362423
ISBN-10: 3825362426
Erscheinungsjahr: 2014
Reihe: Beihefte zur Germanisch-Romanischen Monatsschrift
Herausgeber*innen: Jan Mohr, Michael Waltenberger
Sprache: Deutsch
Zustand: Neu
Herausgeber*innen: Jan Mohr, Michael Waltenberger
Sprache: Deutsch
Zustand: Neu
Weitere Bücher der Reihe »Beihefte zur Germanisch-Romanischen Monatsschrift«




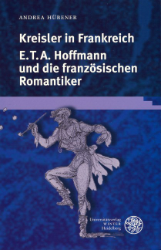
Hübener, Andrea
Kreisler in Frankreich
E.T.A. Hoffmann und die französischen Romantiker (Gautier, Nerval, Balzac, …
Kreisler in Frankreich
E.T.A. Hoffmann und die französischen Romantiker (Gautier, Nerval, Balzac, …
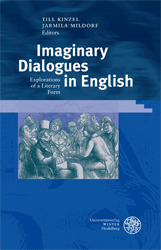
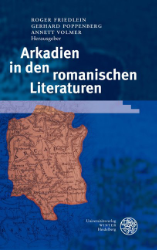
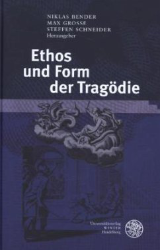
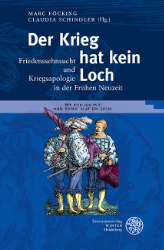
Weitere Bücher im Sachgebiet »Allg. u. vergleich. Literaturwissenschaft«
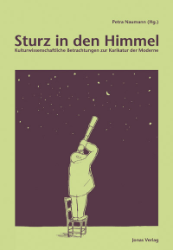
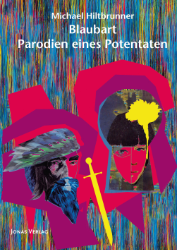
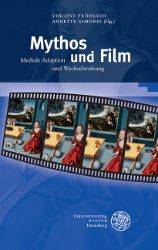

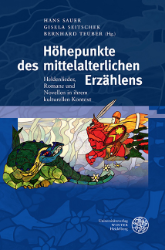
Höhepunkte des mittelalterlichen Erzählens
Heldenlieder, Romane und Novellen in ihrem kulturellen Kontext
Heldenlieder, Romane und Novellen in ihrem kulturellen Kontext

Bender, Niklas
Kampf der Paradigmen - Die Literatur zwischen Geschichte, Biologie und Medizin
Flaubert, Zola, Fontane
Kampf der Paradigmen - Die Literatur zwischen Geschichte, Biologie und Medizin
Flaubert, Zola, Fontane