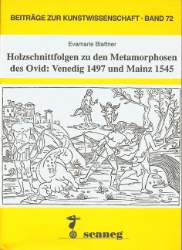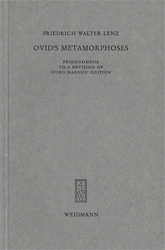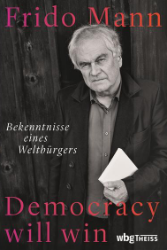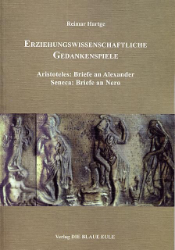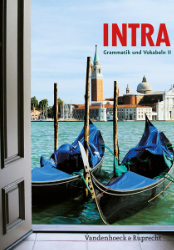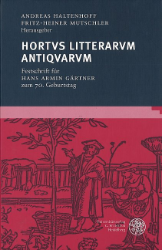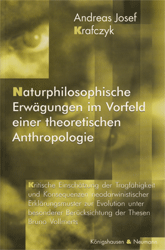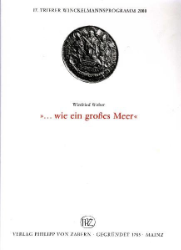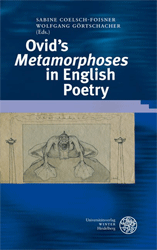Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
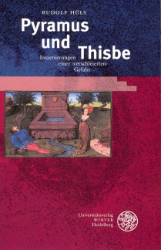
Hüls, Rudolf
Pyramus und Thisbe
Inszenierungen einer 'verschleierten' Gefahr. Mit einem Geleitwort von Silke Leopold. Der Historiker und Altphilologe Rudolf Hüls folgt der Rezeptionsgeschichte von Ovids Liebesgeschichte in allen ihren Verästelungen, untersucht die literarischen, künstlerischen und musikalischen Aneignungen des Stoffes über die Sprachgrenzen hinweg und bis in das 19. Jahrhundert hinein; dass auch die Beatles sich 1964 mit Pyramus und Thisbe beschäftigt haben, bleibt ebenfalls nicht unerwähnt und zeigt, wie aktuell die Beschäftigung mit den uralten Sujets auch in einer Zeit vermeintlicher Geschichtsvergessenheit geblieben ist. - Ovids Liebesgeschichte von Pyramus und Thisbe hat ein reiches Nachleben entfaltet. Am Beispiel der Schlüsselszene, in der Thisbe an einer Quelle auf Pyramus wartet und vor einer herannahenden Löwin flieht, wird gezeigt, wie das Motiv - nicht zuletzt durch Boccaccios Vermittlung - in die europäischen Nationalliteraturen gewandert ist. Von Shakespeares oder Viaus Bühnenfassungen war es dann nur noch ein kleiner Sprung zur Barockoper mit ihren vor allem italienischen Libretti. Der Autor beschreibt die Traditionsstränge, die dem Sujet mal tragische, mal komische, mal moralisierende Züge verleihen, macht auf William Shakespeare aufmerksam, dessen tragische Verarbeitung in 'Romeo and Juliet' einerseits und dessen komische Bearbeitung in 'A Midsummer Night's Dream' andererseits die Weichen für alle weitere Auseinandersetzung mit dem Stoff stellten und geht schließlich auch auf die zahlreichen musikalischen Bearbeitungen in Kantate und Oper sowohl der italienischen als auch der französischen Tradition ein. Und an keiner Stelle ist von dem unter klassischen Philologen so verbreiteten Bedauern über die vermeintlich unzulässige Libertinage die Rede, mit der spätere Autoren die antike Quelle veränderten; statt dessen ist dieses Buch des Staunens darüber voll, welche Bandbreite der Verständnis- und Bearbeitungsmöglichkeiten das Sujet der bittersüßen Liebe von Pyramus und Thisbe im Verlauf von mehr als 2000 Jahren geboten hat. Ausblicke auf die Kunst und eine philologische Untersuchung zur Bezeichnung der ovidianischen Schlüsselbegriffe in den europäischen Literaturen runden die Arbeit ab. Die im Anhang zusammengestellten Testimonien umfassen vor allem Belege auf Italienisch, Spanisch, Französisch, Englisch, Niederländisch und Deutsch. -- Aus dem Inhalt: I. Die Herkunft des Motivs und seine Ausgestaltung in der Antike; II. Renaissance im lateinischen Mittelalter; III. Der Weg in die Nationalsprachen; IV. Der moralisierte Ovid - Die Kirche folgt dem Zeitgeschmack; V. Die frühen Drucke und ihre Illustrierungen - "Abkupfern" ist erlaubt; VI. Thisbe als "Muss" für die bildende Künstler; VII. Die poetische Herausforderung; VIII. Der Weg auf die Bühne: tragisch oder komisch? IX. Nun singen oder tanzen sie auch: der Weg zum musikalischen Pathos; X. Metamorphosen der Metamorphose: Kontinuität und Innovation im Sprachgebrauch. - Anhang I: Daten zu Pyramus und Thisbe in Mittelalter und Neuzeit. - Anhang II: Testimonia aus Mittelalter und Neuzeit. - 322 Seiten mit 24 Abb., broschiert (Kalliope. Studien zur griechischen und lateinischen Poesie; Band 5/Universitätsverlag Winter 2005)
Bestell-Nr.: 31190
ISBN-13: 9783825351199
ISBN-10: 382535119X
Erscheinungsjahr: 2005
ISBN-13: 9783825351199
ISBN-10: 382535119X
Erscheinungsjahr: 2005
Bindungsart: broschiert
Umfang: 322 Seiten mit 24 Abb.
Gewicht: 387 g
Verlag: Universitätsverlag Winter
Umfang: 322 Seiten mit 24 Abb.
Gewicht: 387 g
Verlag: Universitätsverlag Winter
Reihe: Kalliope. Studien zur griechischen und lateinischen Poesie
Autor*in: Rudolf Hüls
Sprachen: Deutsch, Mehrere Sprachen
Zustand: Neu
Autor*in: Rudolf Hüls
Sprachen: Deutsch, Mehrere Sprachen
Zustand: Neu
Weitere Bücher der Reihe »Kalliope. Studien zur griechischen und lateinischen Poesie«

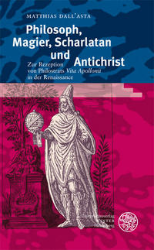
Dall'Asta, Matthias
Philosoph, Magier, Scharlatan und Antichrist
Zur Rezeption von Philostrats "Vita Apollonii" in der Renaissance
Philosoph, Magier, Scharlatan und Antichrist
Zur Rezeption von Philostrats "Vita Apollonii" in der Renaissance
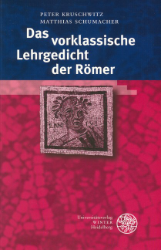
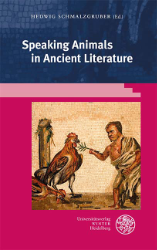
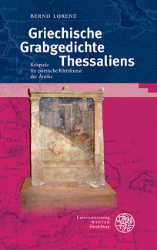


Häger, Hans-Joachim
Plinius über die Ehe und den idealen Ehemann
Zur literarischen Inszenierung von Männlichkeiten und Emotionen in Ehe und …
Plinius über die Ehe und den idealen Ehemann
Zur literarischen Inszenierung von Männlichkeiten und Emotionen in Ehe und …

Weinczyk, Raimund Johann
Eoban und Ovid
Helius Eobanus Hessus' Brief an die Nachwelt und Ovids Tristien - Spurensuche …
Eoban und Ovid
Helius Eobanus Hessus' Brief an die Nachwelt und Ovids Tristien - Spurensuche …
Weitere Bücher im Sachgebiet »Ovid«

Moog-Grünewald, Maria
Metamorphosen der 'Metamorphosen'
Rezeptionsarten der ovidischen Verwandlungsgeschichten in Italien und Frankreich …
Metamorphosen der 'Metamorphosen'
Rezeptionsarten der ovidischen Verwandlungsgeschichten in Italien und Frankreich …
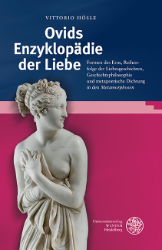
Hösle, Vittorio
Ovids Enzyklopädie der Liebe
Formen des Eros, Reihenfolge der Liebesgeschichten, Geschichtsphilosophie und …
Ovids Enzyklopädie der Liebe
Formen des Eros, Reihenfolge der Liebesgeschichten, Geschichtsphilosophie und …
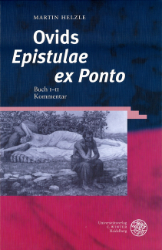
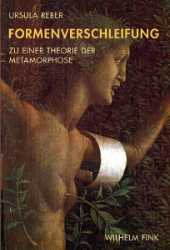
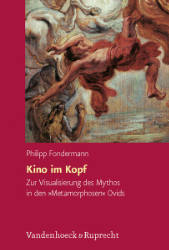
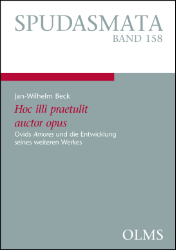
Beck, Jan-Wilhelm
Hoc illi praetulit auctor opus
Ovids 'Amores' und die Entwicklung seines weiteren Werkes
Hoc illi praetulit auctor opus
Ovids 'Amores' und die Entwicklung seines weiteren Werkes