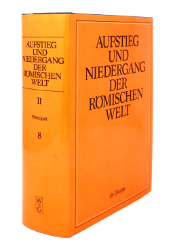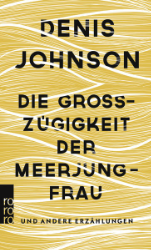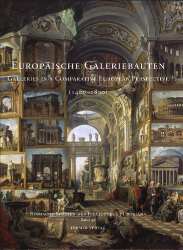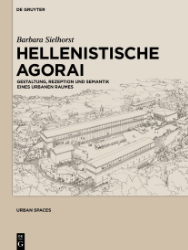
Sielhorst, Barbara: Hellenistische Agorai
Gestaltung, Rezeption und Semantik eines urbanen Raumes. Im Zentrum der Untersuchung stehen hellenistische Agorai, deren Gestaltung mittels Gebäuden, Wegen und Monumenten im Hinblick auf ihre Aussagefähigkeit über den formalen, ästhetischen, inhaltlichen und sozialen Wandel dieses Raumes analysiert wird. In der auf Griechenland, die Ägäis und den Westen Kleinasiens fokussierten Arbeit werden Agorai als symbolisch aufgeladene Räume betrachtet, deren Analyse Rückschlüsse auf die sie prägenden und von ihnen geprägten Gesellschaften ermöglicht. Agorai entwickelten sich im Hellenismus zu den Kristallisationsorten einer monumentalisierten, polisspezifischen Identität. Im 2. Jh. v. Chr. erfolgte eine systematische Einfassung der Agorai mit Gebäuden. Insbesondere die Verwendung der Stoa sorgte für einen Abschluss der Plätze nach außen, während die Platzflächen verstärkt durch Monumente strukturiert und in Teilräume gegliedert worden sind. Das agonale Verhalten der lokalen Eliten um eine adäquate Repräsentation auf den Plätzen machte hellenistische Agorai zu dauerhaften, moralischen Leitbildern und zu Zentren der städtischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ausgehend von der These, dass sich hellenistische Agorai in ihrer architektonischen Ausgestaltung von denen der Archaik und Klassik deutlich unterscheiden, stellen sich folgende Fragen: Wie kam es zu einem solchen Bedeutungszuwachs des gestalteten öffentlichen Raumes, der sich anhand der zunehmenden Ausgestaltung der Plätze feststellen lässt? Erfüllten Agorai im Hellenismus andere gesellschaftliche Funktionen als in den Epochen zuvor? In welchem Verhältnis steht dies zur neuartigen Gestaltung und Wahrnehmung der Plätze durch den antiken Betrachter? Können daraus epochenspezifische Gestaltungsprinzipien für hellenistische Agorai abgeleitet werden - und wenn ja, wie sehen diese aus? Und: Wie wurde der Raum der Agora durch die dort agierende Gesellschaft geprägt und wie wirkte er auf sie zurück? Ziel der Arbeit ist es, die Beziehung zwischen materieller Gestaltung, Wahrnehmung und Semantik jenes Platzes genauer zu erforschen, der für die antike Stadt von so herausragender Bedeutung ist. Im Zuge der Analyse und Interpretation werden unterschiedliche Theorien aus dem Bereich der Raum- und Gedächtnistheorie, der Kultursemiotik, der Rezeptionsästhetik sowie der Architektursoziologie angewandt, die einen synthesegerichteten Blick auf grundsätzliche Gestaltungstendenzen dieses Platztypus ermöglichen. X,354 Seiten mit 169 Abb., Großformat, gebunden (Urban Spaces; Band 3/De Gruyter 2015) leichte Lagerspuren