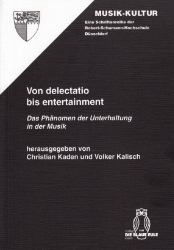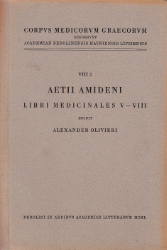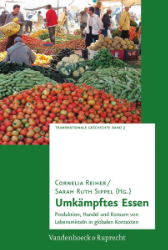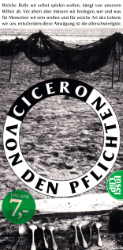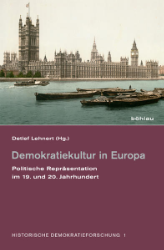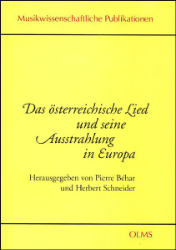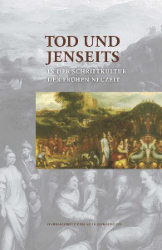Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.

Wahn, Witz und Wirklichkeit
Poetik und Episteme des Wahns vor 1800. Hrsg. von Nina Nowakowski und Mireille Schnyder.Der Wahn vor der Zeit des Wahnsinns war Wissensform und Mittel der Selbsterkenntnis, Begründung einer Poetik des Wirklichen und Bedingung von gesellschaftlicher Kommunikation. Vor 1800, der Zeit vor dem Wahnsinn, ist im Begriff »Wahn« die Perspektivität der Wahrnehmung, die Aspekthaftigkeit der Wirklichkeit und die Zeitlichkeit der Dinge gefasst. In Verbindung mit dem »Witz«, dem intellektuellen Scharfsinn, wird der Wahn zu einem Instrument des kreativen Imaginierens, der Erkenntnis und Weltdeutung sowie der Selbstreflexion. Sein Medium ist die Sprache, in erster Linie dann auch die verschriftlichte Sprache. So lässt sich eine Wahn-Poetik erkennen, die eng mit Imaginations- und Wirklichkeitskonzepten sowie Wissensund Gesprächskulturen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit verbunden ist. Elf Beiträge, gegliedert in die Themenfelder "Kunst des wãn", "Medien des won", "Gewitzter Wahn" und "Verkörperter Wahn", widmen sich aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema. -- Aus dem Inhalt: Susanne Köbele: Owẽ owẽ, daz wænen. Liebeswahn, lusorisch. Zu Hadamars von Laber Jagd; - Nina Nowakowski: Hoffnungsvoller wãn. Zuversicht und Freude bei Walther von der Vogelweide; - Julia Frick: Konstruktionen des »Wahn« in Sebastian Brants 'Narrenschiff' (1494) und Jakob Lochers 'Stultifera navis' (1497); - Susanne Reichlin: Eine Welt voller Geld. Wahnhaftes Begehren, leere Versprechungen und produktive Imaginationen in Flugblättern des 17. Jahrhunderts; - Oliver Grütter: Wahn und Wonne: Zur Poetik des »wohns« in G. R. Weckherlins Dichtung; - Renate Lachmann: Wahn, Aber-Witz und Scharfsinn; - Marco Neuhaus: Überstudierte Phantasten. Exzesse der Gelehrsamkeit und Einbildungskraft bei Beer und Grimmelshausen; - Daniela Fuhrmann: »Allerley Grillen«. Imagination, Literatur und Wirklichkeit im 'Corylo' und 'Jucundus' Johann Beers; - Maximilian Bergengruen: »Des Körpers Wahn«. Zur politischen Logik stoischer Psychologie in Daniel Caspar von Lohnsteins 'Epicharis'; - Felix Knode: Witz als Entfremdung. Salomon Gessners empfindsame Dichtungstheorie in den Idyllen von 1756; - Kaltërina Latifi: The Author run Mad oder Die Methode des Verrückens im 'Tristram Shandy'. 302 Seiten mit 15 Farb- und s/w-Abb., broschiert (Traum - Wissen - Erzählen; Band 11/Brill | Fink 2021) leichte Lagerspuren
Bestell-Nr.: 131002
ISBN-13: 9783770566754
ISBN-10: 3770566750
Erscheinungsjahr: 2021
ISBN-13: 9783770566754
ISBN-10: 3770566750
Erscheinungsjahr: 2021
Bindungsart: broschiert
Umfang: 302 Seiten mit 15 Farb- und s/w-Abb.
Gewicht: 539 g
Verlag: Brill | Fink
Umfang: 302 Seiten mit 15 Farb- und s/w-Abb.
Gewicht: 539 g
Verlag: Brill | Fink
Reihe: Traum - Wissen - Erzählen
Herausgeber*innen: Mireille Schnyder, Nina Nowakowski
Sprache: Deutsch
Zustand: Wie neu, leichte Lagerspuren
Herausgeber*innen: Mireille Schnyder, Nina Nowakowski
Sprache: Deutsch
Zustand: Wie neu, leichte Lagerspuren
Weitere Bücher der Reihe »Traum - Wissen - Erzählen«

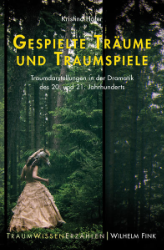
Höfer, Kristina
Gespielte Träume und Traumspiele
Traumdarstellungen in der Dramatik des 20. und 21. Jahrhunderts
Gespielte Träume und Traumspiele
Traumdarstellungen in der Dramatik des 20. und 21. Jahrhunderts
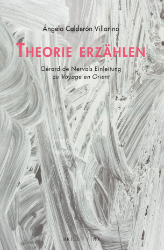
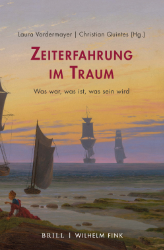
Weitere Bücher im Sachgebiet »Neuere deutsche Literaturwissenschaft epocheübergreifend«
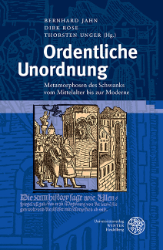
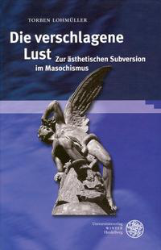
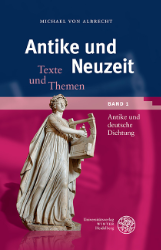

Albrecht, Michael von
Antike und Neuzeit. Texte und Themen
Drei Bände, komplett. Band 1: Antike und deutsche Dichtung. Band 2: Antike …
Antike und Neuzeit. Texte und Themen
Drei Bände, komplett. Band 1: Antike und deutsche Dichtung. Band 2: Antike …



Fritz, Franziska
Wir Unglaubensgenossen
Die Genese der säkularen Option von Jean Paul bis Malwida von Meysenbug
Wir Unglaubensgenossen
Die Genese der säkularen Option von Jean Paul bis Malwida von Meysenbug