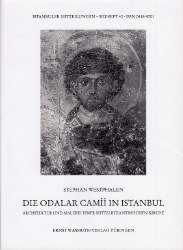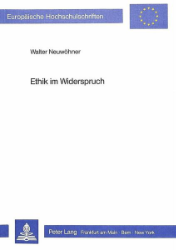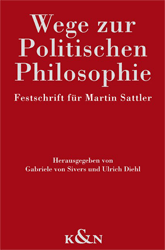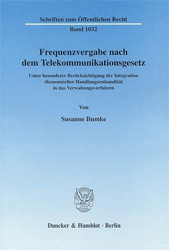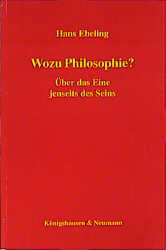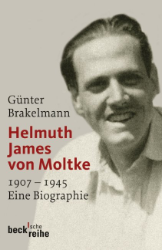Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.

Döge, Melanie
Der Entwurf eines Handelsgesetzbuches für die Stadt Frankfurt am Main von 1811. Band I
Band I: Entstehen, Inhalt und Wirkung. Die Arbeit schildert eingehend den Versuch einer Gesetzgebung im Spannungsfeld zwischen den von der französischen Schutzmacht aufgedrängten Vorstellungen und der Bewahrung überkommener Rechte sowie das Scheitern des Entwurfs. - Napoléons Eroberungs- und Bündnispolitik führte in Deutschland zum Verfall des Heiligen Römischen Reiches und zur Gründung des Rheinbundes. Die ehemalige Freie Reichsstadt Frankfurt wurde Hauptstadt des gleichnamigen Großherzogtums unter Napoléons Verbündetem Dalberg. Französisches Recht wurde weitgehend eingeführt, allerdings mit Ausnahme des Handelsrechts. Die Frankfurter Kaufmannschaft legte stattdessen einen eigenen HGB-Entwurf vor, der äußerlich das fremde Recht aufnahm, im Kern aber die hergebrachten Institutionen und Regeln übernahm. Verfasser des Entwurfs war Johann Friedrich Heinrich Schlosser, ein Neffe von Goethes Schwager, Rechtskonsulent der Frankfurter Handelskammer und Stadtgerichtsrat. In seinem Nachlass fanden sich die in der Publikation veröffentlichten Materialien als Entwurf. Der erste Band stellt Entstehen, Inhalt und Wirkung des Entwurfs eines Handelsgesetzbuches für die Stadt Frankfurt am Main von 1811 dar: Untersucht werden: Politisches Umfeld, Bedeutung und Scheitern des Entwurf; Überkommenes und neues Frankfurter Handelsrecht; Im Entwurf nicht berücksichtigte Materien; Die weitere Entwicklung und Einfluss des Entwurfs; Die Einordnung des Entwurfs. -- Im Detail möchte die Arbeit einen Erkenntnisbeitrag zu drei verschiedenen, miteinander verschränkten Bereichen liefern: Zunächst geht es um die Schilderung des äußeren Ablaufs des Versuchs einer Handelsgesetzgebung für die Stadt Frankfurt am Main im Jahre 1811, den Inhalt des Entwurfs und die Gründe für sein Scheitern. Dahinter steht die Frage, ob es sich bei diesem Entwurf tatsächlich um ein an Bedürfnissen Frankfurts ausgerichtetes und auf sie zugeschnittenes Gesetzesvorhaben gehandelt hat, oder ob Karl Theodor von Dalberg mit einer bloßen Kopie des Code de Commerce Gesetzgebung als Instrument einsetzen wollte, um politische oder persönliche Ziele zu erreichen. Denkbar ist ferner, dass der Entwurf auf Drängen Napoleons zurückzuführen ist, der möglicherweise mit Hilfe einer vereinheitlichten Gesetzgebung im Vorfeld der Französischen Republik einen einheitlichen, französischem Einfluss unterliegenden Rechts- und Wirtschaftsraum schaffen wollte. Hierfür wird ein kurzer Überblick über die politischen und staatsrechtlichen Verhältnisse des Großherzogtums und der Stadt Frankfurt in den fraglichen Jahren und das Heranziehen der hierfür einschlägigen geliefert. Auch die Person Dalberg und seine Beziehungen zu Napoleon sind in diesem Zusammenhang zu beleuchten. Das zweite Erkenntnisziel der Arbeit besteht in einer klassischen Handelsrechtsvergleichung im historischen Längsschnitt: Hatten die Institutionen des HGB-Entwurfs Vorläufer im alten Frankfurter Handelsrecht, oder wurden als Vorbilder auch Rechtsregeln und Vorschriften, die in anderen deutschsprachigen Gebieten galten, herangezogen? In diesem Zusammenhang sind auch die im Entwurf nicht berücksichtigten handelsrechtlichen Materien zu betrachten. Handelsrechtlichen Vorläufern wird lediglich dort nachgespürt, wo die Vorschriften des Entwurfs von denen des Code de Commerce abweichen. Festzuhalten ist: Es konnte an keiner Stelle, an der Vorschriften des Entwurfs von den Regeln des Code de Commerce abweichen, festgestellt werden, dass der Entwurf insoweit selbständig auf die Ordonnance du Commerce zurückgegriffen hätte. Wenn es also Verbindungslinien zwischen dem Entwurf und der Ordonnance oder sonstigem älterem französischem Handelsrecht gibt, dann sind diese - soweit ersichtlich - ausschließlich durch den Code de Commerce vermittelt und aus diesem übernommen worden. Zu dem eingegrenzten historischen Längsschnitt gehört sodann eine Betrachtung dazu, ob der Entwurf in der späteren Handelsrechtsentwicklung nach 1811 Auswirkungen in Frankfurt oder im Deutschen Bund hatte. In theoretischer Sicht stellt die Übernahme der napoleonischen Gesetzgebung in einzelnen deutschen Staaten ein bemerkenswertes historisches Beispiel für einen Rezeptionsvorgang, genauer, einen "legal transplant", dar. In einem weiteren Teil der Arbeit ist zu fragen, ob auch mit dem hier betrachteten HGB Entwurf für Frankfurt ein "legal transplant" beabsichtigt war, welche Vorbedingungen im Fall eines "legal transplant" erfüllt sein müssen, welche Probleme bei solchen Rechtsübertragungen auftreten, und ob diese Probleme auch im Zusammenhang eine Rolle gespielt haben. Eine abschließende Würdigung, die die politische Ausgangslage und frühere Reformansätze, die Besonderheit des Frankfurter HGB-Entwurfs von 1811 und seine Einordnung als Mischtypus berücksichtigt, bildet den Schluss der Arbeit. XIV,276 Seiten, Leinen (Universitätsverlag Winter 2016)
Bestell-Nr.: 14683
ISBN-13: 9783825364939
ISBN-10: 3825364933
Erscheinungsjahr: 2016
ISBN-13: 9783825364939
ISBN-10: 3825364933
Erscheinungsjahr: 2016
Weitere Bücher im Sachgebiet »Rechtsgeschichte des 19. Jahrhunderts«
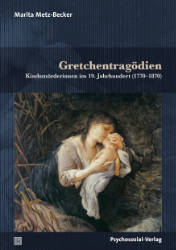

Döge, Melanie
Der Entwurf eines Handelsgesetzbuches für die Stadt Frankfurt am Main von 1811. Band II
Band II: Texte und Materialien
Der Entwurf eines Handelsgesetzbuches für die Stadt Frankfurt am Main von 1811. Band II
Band II: Texte und Materialien
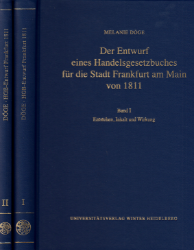
Döge, Melanie
Der Entwurf eines Handelsgesetzbuches für die Stadt Frankfurt am Main von 1811. Zwei Bände
Zwei Bände (komplett). Band I: Entstehen, Inhalt und Wirkung. Band II: Texte …
Der Entwurf eines Handelsgesetzbuches für die Stadt Frankfurt am Main von 1811. Zwei Bände
Zwei Bände (komplett). Band I: Entstehen, Inhalt und Wirkung. Band II: Texte …


Repgen, Tilman
Die soziale Aufgabe des Privatrechts
Eine Grundfrage in Wissenschaft und Kodifikation am Ende des 19. Jahrhunderts
Die soziale Aufgabe des Privatrechts
Eine Grundfrage in Wissenschaft und Kodifikation am Ende des 19. Jahrhunderts

Eckardt, Martina
Technischer Wandel und Rechtsrevolution
Ein Beitrag zur ökonomischen Theorie der Rechtsentwicklung am Beispiel des …
Technischer Wandel und Rechtsrevolution
Ein Beitrag zur ökonomischen Theorie der Rechtsentwicklung am Beispiel des …

Fischer, Horst
Judentum, Staat und Heer in Preußen im frühen 19. Jahrhundert
Zur Geschichte der staatlichen Judenpolitik
Judentum, Staat und Heer in Preußen im frühen 19. Jahrhundert
Zur Geschichte der staatlichen Judenpolitik

Ahrens, Martin
Prozessreform und einheitlicher Zivilprozess
Einhundert Jahre legislative Reform des deutschen Zivilverfahrensrechts vom …
Prozessreform und einheitlicher Zivilprozess
Einhundert Jahre legislative Reform des deutschen Zivilverfahrensrechts vom …

Löhnig, Martin
Rechtsvereinheitlichung trotz Rechtsbindung
Zur Rechtsprechung des Reichsgerichts in Zivilsachen 1879-1899
Rechtsvereinheitlichung trotz Rechtsbindung
Zur Rechtsprechung des Reichsgerichts in Zivilsachen 1879-1899