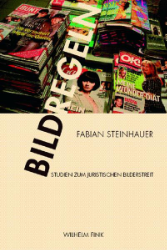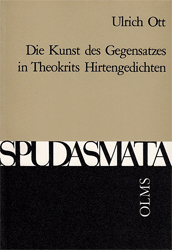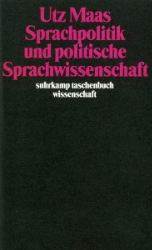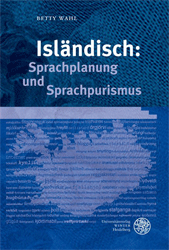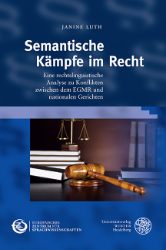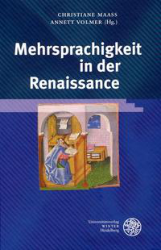
Mehrsprachigkeit in der Renaissance
Hrsg. von Christiane Maaß und Annett Volmer. Der Band zeigt das Phänomen der Mehrsprachigkeit als eine Spezifik der Renaissance: Autoren bewegten sich zwischen verschiedenen sprachlichen Zeichensystemen. 16 Beiträge untersuchen die alt- und neusprachliche Mehrsprachigkeit unterschiedlicher Sprechergruppen sowie ihr Verhältnis zu den unterschiedlichen "volgari". Die Beiträge gehen zurück auf ein Symposium, das an der Freie Universität Berlin vom November 2002 stattfand. Der Band gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Mehrsprachigkeit im Renaissancehumanismus: Latein - Griechisch - Hebräisch - Gemeinsprachen. - 2. Dialekte und Mehrsprachigkeit. - 3. Sprachwahl und Identität. - 4. Genderspezifische Aspekte von Mehrsprachigkeit. - Übersetzung zwischen Ein- und Mehrsprachigkeit. - Die Beiträge dieses Bandes stellen die Sprachgemeinschaft der Renaissance als prinzipiell offene dar, in der sich Autoren zwischen verschiedenen sprachlichen Zeichensystemen bewegten. Am Phänomen der Mehrsprachigkeit wird dabei eine Spezifik der Renaissance fassbar: Während Nationen seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts als tendenziell abgeschlossene Sprachgemeinschaften existieren, war die Koexistenz mehrerer Schriftsprachen für die Renaissance charakteristisch und verbindlich. Im Band wird die alt- und neusprachliche Mehrsprachigkeit unterschiedlicher Sprechergruppen sowie ihr Verhältnis zu den unterschiedlichen "volgari" untersucht. Auch genderspezifische Aspekte von Mehrsprachigkeit werden in den Blick genommen, wirkt doch hier die altsprachliche Mehrsprachigkeit des Humanismus tendenziell exkludierend. - Aus dem Inhalt: Christiane Maaß: Mehrsprachigkeit. Sprachbewusstsein in der Renaissance zwischen Ideal und textueller Praxis. - Gabriella Albanese: Mehrsprachigkeit und Literaturgeschichte im Renaissancehumanismus. - Letizia Leoncini: Latein, Volgare, Griechisch. Koexistenz und Interferenz in der Evolution der Literatursprachen von Dante bis zur Renaissance. - Sandra Pott: Zweisprachigkeit oder Mehrsprachigkeit? Muster der Selbstbeschreibung in der poetologischen Lyrik des deutschen Humanismus. - Christoph Hoch: Mehrsprachigkeit als Reflexionsfigur. Mittelalter-Anschluss und Kanon-Kommentar in der polyglotten Lyrik des Siglo de Oro. - Raffaele Sirri: Fälle von Bilinguismus im Cinquecento. - Teresa Cirillo: Bilinguismus und Dialekt. Der Fall Giovan Battista della Porta. - Sabine Greiner: Die Funktionalität des Dialekts bei Ruzante. - Ursula Kocher: Sprache und Erzählen. Zum Phänomen der Mehrsprachigkeit in der Renaissancenovellistik. - Gabriele Jancke: Sprachverhalten in multilingualem Umfeld. Autobiographisches Schreiben des 15. und 16. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum. - Elke Waiblinger: Tante novità. Vom Begreifen und Beschreiben fremder Wirklichkeit. Aus italienischen Asienreiseberichten des 16. Jahrhunderts. - Susanne Gramatzki: Die andere Stimme. Frauen und das Mehrsprachigkeitsideal der Renaissance. - Annett Volmer: "...se non mi giovasse il volgare, mi servirei del latino...". Sprache und Sprachreflexion in Texten italienischer Autorinnen der Renaissance. - Fabrizio Franceschini: Volkssprachliche Mehrsprachigkeit in lateinischen Grammatiken (Buti, Guarino, Perotti, Erasmus). - Ralf Haekel: Übersetzung als Aneignung dramatischer und theatralischer Formen. Die deutschen Versionen von Thomas Tomkis' Lingua und Ben Jonsons Sejanus. - Axel Heinemann: Polyglotte Wörterbücher als Ausdruck einer neuen Mehrsprachigkeit. - 283 Seiten mit 6 Tab., gebunden (Beihefte zur Germanisch-Romanischen Monatsschrift; Heft 21/Universitätsverlag Winter 2005)