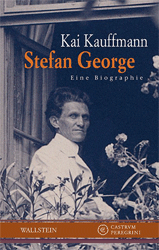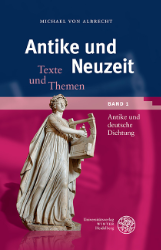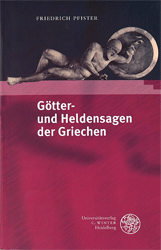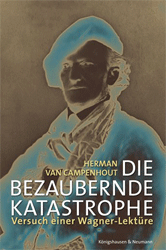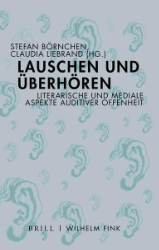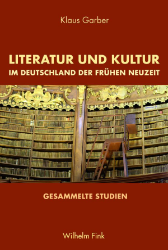Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.

Quellcodekritik
Zur Philologie von Algorithmen. Hrsg. von Hannes Bajohr und Markus Krajewski.Algorithmen greifen ständig in unser Leben ein, und die Quellcodes, in denen sind geschrieben sind, sind in zugleich mehr und weniger als gewöhnliche Sprache. Daher erfordern sie auch eine besondere Philologie. Quellcodekritik ist der Versuch, Algorithmen zu erschließen, zu interpretieren und sie zugänglich zu machen und so der Asymmetrie der Kenntnisse von Programmierern und Geisteswissenschaftlern entgegenzuwirken. »Verdienstvoll - diese Dynamiken zu durchschauen, ist ein erster Schritt, um mit ihnen umzugehen« (Manuela Lenzen im "Philosophie Magazin"). Den Autoren dieses Bandes geht es darum, "Programmieren als Kulturtechnik zu fördern und Geisteswissenschaftlern die notwendigen Fähigkeiten an die Hand zu geben, Software zu verstehen und produktiv kritisieren zu können. [...] Im Grunde geht es bei der Quellcodekritik darum, die Methoden der Medienwissenschaft anschluss- und zukunftsfähig zu halten, auch um sich interdisziplinär auf Augenhöhe mit anderen Praktikern austauschen und daran arbeiten zu können, IT-Quatsch von relevanten Phänomenen zu sondern. Insofern ist 'Quellcodekritik' ein wichtiges Buch" (Günter Hack in der F.A.Z.). - Algorithmen bestimmen unsere Lage. Vom Google-PageRank-Algorithmus bis zur Kreditvergabe greift ihre Logik auf Schritt und Tritt in unser Leben ein. Einige von ihnen arbeiten undurchsichtig und schirmen ihr Innenleben vor neugierigen Blicken ab. Andere bemühen sich um Transparenz und folgen einer Ethik des Open Source. In beiden Fällen ist jedoch ein nicht unerheblicher Aufwand erforderlich, um die Quellcodes zu verstehen, in denen Algorithmen geschrieben sind. Codes sind besondere Texte: Sie setzen Befehle um, wenn sie ausgeführt werden, und reduzieren Expression auf Direktiven. Sie sind somit mehr und weniger als gewöhnliche Sprache. Zugleich führen sie mit der Möglichkeit zur Kommentierung stets eine Metaebene mit, auf der man sich über ihre Funktionsweise verständigen kann. Daher erfordern sie auch eine besondere Philologie. Die Quellcodekritik, die dieser Band vorstellt, ist der Versuch, Algorithmen zu erschließen, zu interpretieren und sie gegenwärtigen wie zukünftigen Leser*innen zugänglich zu machen. Sie mobilisiert einen Zugriff, der in der Informatik ebenso zu Hause ist wie in der Textkritik. Zugleich schlägt sie Strategien vor, auch mit jenen neuen Sprachmodellen umzugehen, in denen Codes nur am Anfang stehen, während ihr statistisches Inneres undurchdringlich bleibt. Die Beiträge liefern so Beispiele und Methoden, wie klassischer Code und künstliche Intelligenz lesbar zu machen sind. - Zehn Beiträge, gegliedert in zwei Themenfelder: I. Das sequenzielle Paradigma; II. Das konnektionistische Paradigma. - Aus dem Inhalt: Hannes Bajohr/Markus Krajewski: Quellcodekritik. ReadMe1st.txt. - Mark C. Marino: Critical Code Studies. Ein Manifest. - Markus Krajewski: Kulturtechnik Programmieren. Quellcode kritisieren. Drei Beispielszenarien. - Till A. Heilmann: Wie liest man 100.000 Zeilen Code? - Dan Verständig: Programmieren mit Copilot. Über Grenzen der Automatisierung und Formen von Subjektivierung. - Matthew Kirschenbaum: Spec Acts. Formales Lesen in rekurrenten neuronalen Netzen. - Hannes Bajohr: Dumme Bedeutung. Künstliche Intelligenz und artifizielle Semantik. - Tyler Shoemaker: Verkettete Textualität. - Leah Henrickson: Mit den Toten chatten. Die Hermeneutik von Thanabots. - Emily Bender/Timnit Gebru/Angelina McMillan-Major/Shmargaret Shmitchell: Über die Gefahren stochastischer Papageien. Können Sprachmodelle zu groß sein? 336 Seiten, broschiert (August Akademie/August Verlag 2024) Lagerspuren
Bestell-Nr.: 19170
ISBN-13: 9783751890205
ISBN-10: 3751890203
Erscheinungsjahr: 2024
ISBN-13: 9783751890205
ISBN-10: 3751890203
Erscheinungsjahr: 2024
Reihe: August Akademie
Herausgeber*innen: Markus Krajewski, Hannes Bajohr
Sprache: Deutsch
Zustand: Sehr gut, Lagerspuren
Herausgeber*innen: Markus Krajewski, Hannes Bajohr
Sprache: Deutsch
Zustand: Sehr gut, Lagerspuren
Weitere Bücher im Sachgebiet »Publizistik, Medienwissenschaften«

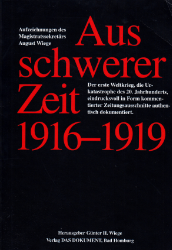
Wiege, August
Aus schwerer Zeit 1916-1919
Der erste Weltkrieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, eindrucksvoll in …
Aus schwerer Zeit 1916-1919
Der erste Weltkrieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, eindrucksvoll in …
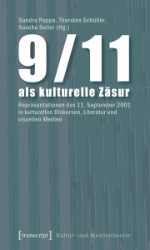
9/11 als kulturelle Zäsur
Repräsentationen des 11. September 2001 in kulturellen Diskursen, Literatur …
Repräsentationen des 11. September 2001 in kulturellen Diskursen, Literatur …


Szczepaniak, Jacek/Gesine Lenore Schiewer/Janusz Pociask
Emotionale Nachbarschaft. Teil 2
Affekte in deutschen und polnischen Pressediskursen. Teil 2: Medienereignisse: …
Emotionale Nachbarschaft. Teil 2
Affekte in deutschen und polnischen Pressediskursen. Teil 2: Medienereignisse: …

Bißmann, Daniel
"Ostexperten und Aktivisten"
Nachrichtendienst und Gewalt zwischen NS-Staat und Sowjetunion
"Ostexperten und Aktivisten"
Nachrichtendienst und Gewalt zwischen NS-Staat und Sowjetunion
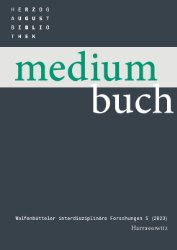
Medium Buch. Band 5 (2023): Inkunabelforschung für morgen - Wege, Ziele, Perspektiven
Tagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte, …
Tagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte, …

Medium Buch. Band 4 (2022): Sammlungen digital denken
Wolfenbütteler interdisziplinäre Forschungen. [Nachfolge der Wolfenbütteler …
Wolfenbütteler interdisziplinäre Forschungen. [Nachfolge der Wolfenbütteler …