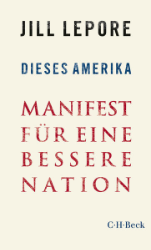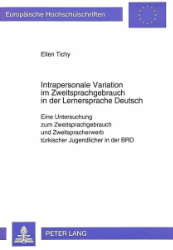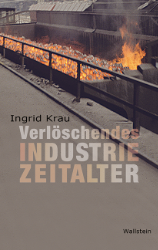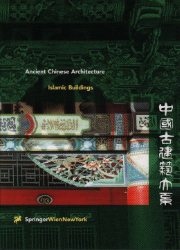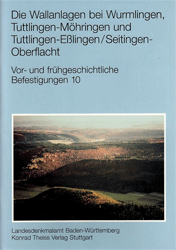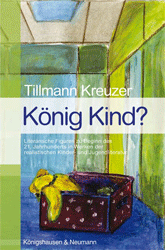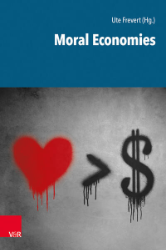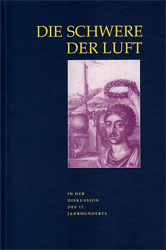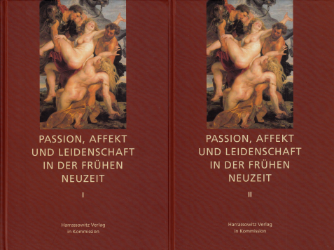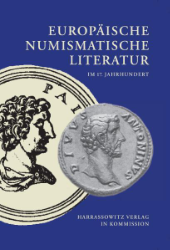Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
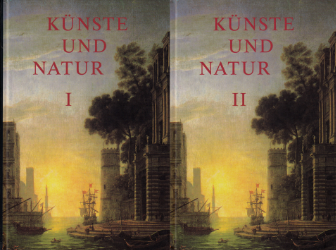
Künste und Natur in Diskursen der Frühen Neuzeit
Zwei Bände, komplett. Unter Mitwirkung von Barbara Becker-Cantarino, Martin Bircher, Ferdinand van Ingen, Sabine Solf und Carsten-Peter Warncke hrsg. [und mit einer Einführung] von Hartmut Laufhütte.Vorträge und Referate gehalten anlässlich des 9. Kongresses des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Barockforschung in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 31. Juli bis 2. August 1997. 65 Kongressvorträge (davon drei in Englisch) gehen der Programmatik und den Perspektiven des Verhältnisses von Natur und Künsten nach, untersuchen die Konstanz und den Wandel im kunsttheoretischen Diskurs, betrachten Fragen der Kunstnormierung und der Entwicklung neuer Gattungen, beschreiben Institution und Medien der Diskussion und der Entwicklung von Kunstlehren. Die Beiträge untergliedern sich in sechs Themenfelder: Band 1: I. Programmatik, Perspektiven (Die Vorträge im Plenum); - II. Konstanz und Wandel im kunsttheoretischen Diskurs (Referate der Sektion 1); - III. Kunstnormierung, Entwicklung neuer Genera (Referate der Sektion II). Band 2: IV. Institutionen und Medien der Diskussion und der Entwicklung von Kunstlehren (Referate der Sektion III); - V. Rhetorik und Kunstlehren (Referate der Sektion IV); - VI. Technik und Kunstlehren (Referate der Sektion V). Das Nachdenken von Wissenschaftlern und Künstlern über das Verhältnis von Natur und Künsten, über die begründende, orientierende Qualität der Kunst, ihr Bearbeitungs-, Veränderungs-, Deutungsrecht an der Natur oder ihre Abhängigkeit von der Natur ist alt. Das in den sechziger Jahren erwachte Interesse an der Barockliteratur hat der Literatur der frühen Neuzeit in vielen Bereichen ganz neue und andere, vor allem in einzelne Künste und Nationalkulturen übergreifende Zusammenhänge gelehrt, mit bis heute unabsehbaren und weiterwirkenden Folgen für die Kulturgeschichte der Epoche. -- Aus dem Inhalt: Wilfried Bamer: Spielräume. Was Poetik und Rhetorik nicht lehren. - Barbara Bauer: Naturverständnis und Subjektkonstitution aus der Perspektive der frühneuzeitlichen Rhetorik und Poetik. - Wilhelm Schmidt-Biggemann: Welche Natur wird nachgeahmt? Beobachtungen zur Erscheinung der Natur in der barocken Literatur. - Karl Möseneder: Ars docta ֊ Joachim von Sandrarts Teutsche Academie. - Friedhelm Krummacher: Norm und Individualität. Über Komposition und Theorie im 17. Jahrhundert. - Áron Kibédi Varga: Alte und neue Formen der Multimedialität. - Barbara Maria Stafford: Analogy in an Age of Difference. - Ansgar M. Cordie: Mimesis bei Aristoteles und in der Frühen Neuzeit. - Paul Richard Blum: Natur im Denken der Renaissance. - Marcus Frings: "Un'altra natura". Das Naturvorbild in der Architekturtheorie der italienischen Renaissance. - Nicola Kaminski: "Initio Davům agam" oder Die folgenreiche Verwechslung von simulatio und dissimulatio. Inszenierung humanistischer imitatio-Diskussion im Ciceronianus des Erasmus von Rotterdam. - Gabriele Frings: "Ars et natura in musica". Zur Beziehung zwischen musiktheoretischer Diskussion und musikalischer Ikonographie in der frühen Neuzeit. - Claudia Benthien: Anatomie im mythologischen Gewand. Kunst und Medizin in Schindungsdarstellungen des 16. und 17. Jahrhunderts. - Kerstin Schwedes: Wortlose Beredsamkeit. Evokatorische Bildsprache von Michelangelos Römischer Pietà und dem Minerva-Christus. - Elisabeth Dalucas: Der Fuß des Perseus. Ansprach und Wirklichkeit Benvenuto Cellinis. - Tanja Michalsky: Imitation und Imagination. Die Landschaft Pieter Bruegels d. Ä. im Blick der Humanisten. - Glenn Ehrstine: Vom Zeichen zum (leeren) Abbild. Das Drama der Frühen Neuzeit als visuelles Medium. - Helmut Loos: Die Kritik an Senecas Tragödie bei Vossius, Heinsius und Grotius. - Elisabeth Оу-Marra: Das Verhältnis von Kunst und Natur im Traktat von Gian Domenico Ottonelli und Pietro da Cortona: "Della pittura et scultura. Uso e abuso loro". - Matthias Bruhn: Die zwei Naturen bei Nicolas Poussin. - Dirk Niefanger: Galanterie. Grundzüge eines ästhetischen Konzepts um 1700. -- Peter Krüger: Auf den Standort kommt es an. Zur Rolle des Horizonts in der Perspektive der Neuzeit. - Roland Kanz: Der Capriccio-Begriff bei Vasari und Gilio in der Kontroverse um Michelangelos "Jüngstes Gericht". - Jens M. Baumgarten: Wirkungsästhetik und Wechselwirkungen: Kunst und Rhetorik in den Traktaten Carlo Borromeos, Gabriele Paleottis und Roberto Bellarminos. - Thomas Kirchner: Religion als Thema der Historienmalerei. - Barbara Welzel: Kunstvolle Inszenierung von Natürlichkeit. Anmerkungen zu den Blumenstilleben Jan Brueghels d. Ä. - Marie-Thérèse Mourey: Die Kunst des Balletts. Rhetorik und Grammatik einer neuen Sprache. - Mara R. Wade: Georg Engelhard Loehneyss' "Deila Cavalleria" als höfische Kunstlehre. - Volker Mergenthaler: Imitatio und ingenium in der Commedia dell'arte. Spuren des Ciceronianismusstreits im Stegreiftheater. - M. A. Katritzky: Carnival and comedy in Georg Straub of St. Gallen's printed "album amicorum" of 1600. - Dietmar Schubert: "Weil immer eine Kunst die ander' liebt und ehrt". Der Beitrag des Leipziger Dichterkreises zur Herausbildung einer deutschsprachigen Kunstdichtung. - Susanne Bauer-Roesch: Gesangspiel und Gesprächspiel. Georg Philipp Harsdörffers "Seelewig" als erste Opemtheorie in deutscher Sprache. - Christiane Caemmerer: Normierung des Neuen. Die deutschen Schäferspiele des 17. Jahrhunderts und ihr Platz in den poetischen Schriften. - Silvia Serena Tschopp: Imitatio und renovatio. Martin Opitz' "Schäfferey Von der Nimfen Hercinie" als Modell der Aneignung literarischer Tradition. - Joachim Leeker: Giambattista Basiles "Lo cunto de li cunti" (1634-36). Novellentheorie und Novellenpraxis zwischen barocker Ästhetik und dem Vorbild Boccaccios. - Helga Meise: Schreibkalender und Autobiographik in der Frühen Neuzeit. - Jutta Breyi: Assenat und Isis - eine poetologische Kontroverse in Bild und Text. Zum Verhältnis von Kunst und Natur bei Philipp von Zesen. - Hellmut Thomke: Leben, Beruf und Kunstauffassung im Spiegel der barocken Musikerromane. - Markus Waldura: Zum Stellenwert der physikalischen Natur in den Musiktheorien Rameaus und Marpurgs - ein Vergleich. - Anne Eusterschulte: Imitatio naturae. Naturverständnis und Nachahmungslehre in Malereitraktaten der frühen Neuzeit. - Kristine Patz und Ulrike Müller Hofstede: "Alberti Teutsch". Zur Rezeption rhetorischer Kunstlehre in Deutschland. - Maike Christadler: Künstlerviten und Geschlechterdifferenz - von Vasari bis Baldinucci. - Karin Hellwig: Reformgedanken in der spanischen Kunstliteratur des 17. Jahrhunderts. - Michael Heinemann: Kategorien der Kompositionskritik in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. - Annette Kollatz: Ästhetik der katholischen Reform am Beispiel der Dramen des Gottfried Lemius SJ (1562-1632). - Dieter Breuer: Ingenium, Phantasia, Argutia in jesuitischen Traktaten zur Dichtkunst. - Doris Gerstl: Joachim von Sandrarts "Teutsche Academie der Edlen Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste" - zur Genese. - Gabriele Ball: Ambivalenzen der Rezeption barocker Kunstformen in Gottscheds Regelsystem. - Gregory S. Johnston: Lamentation to Consolation. Aspects of Music and Rhetoric in Funerary Compositions of the German Baroque. - Sandra Krump: Sinnenhafte Seelenführung. Das Theater der Jesuiten im Spannungsfeld von Rhetorik, Pädagogik und ignatianischer Spiritualität. - Andreas Keller: Spaziergang und Lektüre. Analogien zwischen fiktionaler Bewegung und faktischem Rezeptionsverhalten als hermeneutische Hilfestellung für Textkonzeptionen des 17. Jahrhunderts. - Laura Auteri: Die Kunst der Verstellung bei Virgilio Malvezzi, Johann Moscherosch und Johann Sebastian Mitternacht. - Margherita Cottone: Die Bedeutung des Gartens in der Barockzeit: Gartenkunst und Gartenmetaphorik bei J. G. Schottelius. - Ingrid Höpel: Beziehungen zwischen Sprichwort und Emblem. Justus Georg Schottelius und die "Dreiständigen Sinnbilder" (1643). - Heinz J. Drügh: "Was mag wol klarer seyn?". Zur Ambivalenz des Allegorischen in Andreas Gryphius' Trauerspiel "Leo Armenius". - Ralph Häfner: "Ars apparet ubique miranda". Friedrich Spees "Güldenes Tugend-Buch" und der apologetische Hintergrund der jesuitischen theologia naturalis. - Peter Hess: "Nachäffin der Natur" oder "aller Völker Sprachen"? Zur Rolle visueller Bildlichkeit in Poetik und Rhetorik der Barockzeit. - Cristina M. Pumplum: "Die freyheit des Geistes/ gehet in die Unendlichkeit". Catharina Regina von Greiffenbergs Kompositmetaphem und die ars combinatoria. - Birgit Franke: Natürliche Kunst und künstliche Natur. Ein Beitrag zur Grottenkunst des 16. und frühen 17. Jahrhunderts. - Anita Traninger: "Wie die Buchstabenwechsel zu den Dantzspielen oder Balleten zugebrauchen?" Zur Bedeutung der ars combinatoria für den frühneuzeitlichen Tanz und seine Beschreibung. - Gerhard F. Strasser: Musik(noten)schriften oder die "widernatürliche" Kunst, Musik zu geheimer Kommunikation zu verwenden. - Guillaume van Gemert: Medizinisches Naturverständnis und gegenreformatorisches Literaturprogramm. Zum Stellenwert des erzählerischen Moments in Hippolytus Guarinonius' "Grewel der Verwüstung Menschlichen Geschlechts". - Frank Fehrenbach: Zwei römische Brunnen. Kosmologisches Drama und sublime Gegenwart des Wassers. - Hans Esselbom: Von Sodom zum Phlogiston. Der Schwefel im Spannungsfeld von Naturwissenschaft und Mythologie in Lohensteins Dramen. - Burkhard Dohm: Des Blutes Licht-Tinctur. Alchimistische Konzepte in Hermhutischer Poesie. - Zwei Bände, zus. 1.196 Seiten mit 199 Abb. und einigen Notenbeispielen, gebunden (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung; Band 35/Vorträge und Referate gehalten anläßlich des Jahrestreffens des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Barockforschung in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel; Nr. 9 · 1997/Herzog August Bibliothek in Kommission bei Harrassowitz Verlag 2000)
Bestell-Nr.: 77125
ISBN-13: 9783447042659
ISBN-10: 3447042656
Erscheinungsjahr: 2000
Bände: 2
ISBN-13: 9783447042659
ISBN-10: 3447042656
Erscheinungsjahr: 2000
Bände: 2
Bindungsart: gebunden
Umfang: 1196 Seiten mit 199 Abb. und einigen Notenbeispielen
Gewicht: 2,39 kg
Verlag: Herzog August Bibliothek in Kommission bei Harrassowitz Verlag
Reihe: Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung
Umfang: 1196 Seiten mit 199 Abb. und einigen Notenbeispielen
Gewicht: 2,39 kg
Verlag: Herzog August Bibliothek in Kommission bei Harrassowitz Verlag
Reihe: Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung
Herausgeber*innen: Hartmut Laufhütte, Martin Bircher, Sabine Solf, Barbara Becker-Cantarino, Ferdinand van Ingen, Carsten-Peter Warncke
Sprache: Deutsch
Zustand: Neu
Sprache: Deutsch
Zustand: Neu
Weitere Bücher der Reihe »Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung«
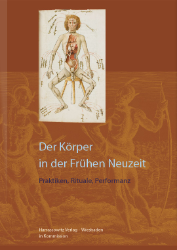
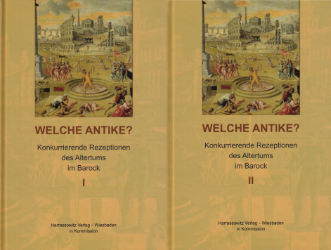
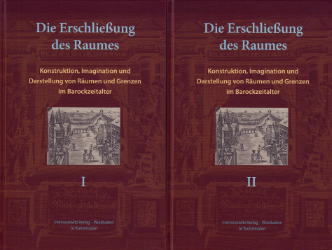
Die Erschließung des Raumes
Konstruktion, Imagination und Darstellung von Räumen und Grenzen im Barockzeitalter …
Konstruktion, Imagination und Darstellung von Räumen und Grenzen im Barockzeitalter …
Weitere Bücher im Sachgebiet »Renaissance/Kunst der Frühen Neuzeit«
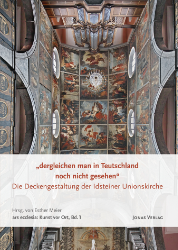
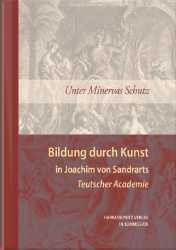
Unter Minervas Schutz
Bildung durch Kunst in Joachim von Sandrarts "Teutscher Academie" [Softcover-Ausgabe] …
Bildung durch Kunst in Joachim von Sandrarts "Teutscher Academie" [Softcover-Ausgabe] …
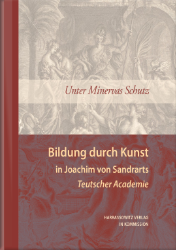
Unter Minervas Schutz
Bildung durch Kunst in Joachim von Sandrarts "Teutscher Academie" [Hardcover-Ausgabe] …
Bildung durch Kunst in Joachim von Sandrarts "Teutscher Academie" [Hardcover-Ausgabe] …
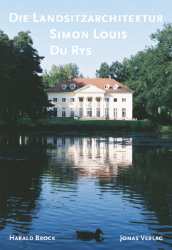

Rapin, René
Hortorum Libri IV/Die Gärten - Gedicht in vier Büchern
Textkritische Ausgabe und Übersetzung
Hortorum Libri IV/Die Gärten - Gedicht in vier Büchern
Textkritische Ausgabe und Übersetzung


Obmann, Jürgen/Derk Wirtz/Philipp Groß
"Ruinirt euch, um Ruinen zu machen"
Antikisierende Ruinenarchitekturen in deutschen Gärten des 18. und frühen …
"Ruinirt euch, um Ruinen zu machen"
Antikisierende Ruinenarchitekturen in deutschen Gärten des 18. und frühen …
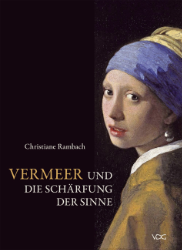
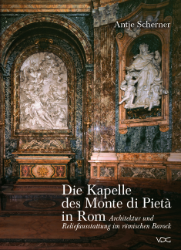
Scherner, Antje
Die Kapelle des Monte di Pietà in Rom
Architektur und Reliefausstattung im römischen Barock
Die Kapelle des Monte di Pietà in Rom
Architektur und Reliefausstattung im römischen Barock