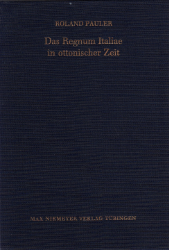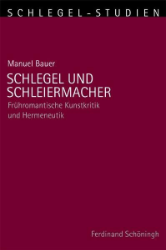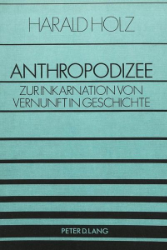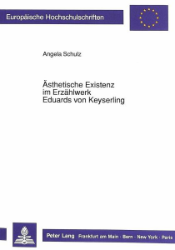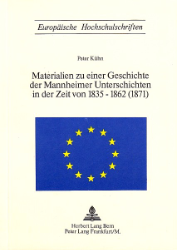Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
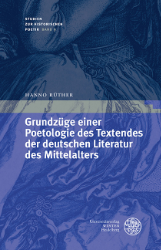
Rüther, Hanno
Grundzüge einer Poetologie des Textendes der deutschen Literatur des Mittelalters
Ob ein Text als Kunstwerk Geltung beanspruchen kann, zeigt sich nicht zuletzt an der Gestaltung seines Endes. Hanno Rüther untersucht diese Gestaltung anhand erzählender Texte des deutschen Mittelalters und beschreibt das Textende als Zusammenspiel von Handlungsende, Textschluss und materiellem Textende. Analysiert werden etwa 30 Texte vom 9. bis zum 16. Jahrhundert. - Im Band geht es darum, am Beispiel von althochdeutscher Literatur, der Tristanromane, der Artusromane von Hartmann von Aue und schwankhafter Erzählungen vom Ehebruch die Bedeutung des Textendes für die Rezeption und Interpretation der deutschen Literatur des Mittelalters herauszuarbeiten. Ob ein Text als Kunstwerk Geltung beanspruchen kann, zeigt sich nicht zuletzt an der Gestaltung seines Endes. Die Literaturwissenschaft hat sich bislang jedoch kaum systematisch mit dem Textende befasst. Diesem Desiderat möchte die Arbeit von Hanno Rüther in Bezug auf erzählende Texte des deutschen Mittelalters entgegenwirken. Methodisch wird dazu jedes Textende als Zusammenspiel von Handlungsende, Textschluss und materiellem Textende beschrieben. Historisch werden etwa 30 Texte aus dem Zeitraum vom 9. bis zum 16. Jahrhundert detailliert untersucht. Dabei erweist sich die althochdeutsche Literatur als strukturell mündlich geprägt und strebt einen quasi formelhaften Schluss an. Je eigene Deutungsabsichten des Stoffes zeigen die Schlussgestaltungen der deutschsprachigen Tristandichtungen. Hartmann von Aue entwickelt in seinen erzählenden Texten eigenständige, von den Vorlagen abweichende Schlusskonzeptionen. Spätmittelalterliche Erzählungen vom Ehebruch versuchen, Anschlusskommunikation zu initiieren und zu steuern. - In Kapitel 2 wird zunächst der Forschungsstand zum Ende literarischer Texte erhoben. In Kapitel 3 wird eine spezifische Methode für die Analyse des Endes literarischer, vor allem narrativer Texte entwickelt, die ein mehrdimensionales Vermessen des Textendes umfasst. Dabei wird auf die Spezifik mittelalterlicher Literatur eingegangen. Im vierten Kapitel geht es um die althochdeutsche Literatur. Dem überlieferten Korpus entsprechend, liegt ein Schwerpunkt dieses Kapitels auf geistlichen Texten. Außerdem bieten die Texte Gelegenheit, das Verhältnis von Fragment und Werk näher zu untersuchen, da einige althochdeutsche Texte nur fragmentarisch überliefert sind. Schließlich hat es seinen besonderen Reiz, die ältesten deutschsprachigen poetischen Texte auf ihr Ende hin zu analysieren, auch um einen Vergleichspunkt zu späteren Texten zu gewinnen. Das fünfte Kapitel untersucht das Ende literarischer Texte, die denselben Erzählstoff darbieten. Es gibt etliche Stoffe, die hier reiche Untersuchungsergebnisse versprechen; keiner allerdings hat einen so prominenten unvollendeten Vertreter zu bieten wie der Tristanstoff, dessen klassische Bearbeitung durch Gottfried von Straßburg Fragment geblieben ist. Die Lage ist hier insofern günstig, als es mit dem Tristanroman Eilharts von Oberge nicht nur eine vollständige Realisierung des Stoffes gibt, sondern auch zwei konkurrierende Fortsetzungen zu Gottfrieds Fragment sowie Gottfrieds altfranzösische Vorlage für den nicht mehr von ihm gedichteten Schluss. Es wird zu ermitteln sein, inwieweit der Stoff die Gestaltung des Handlungsendes verbindlich vorgibt und wo die Freiheit des Autors beginnt. Daneben bietet sich auch die Gestaltung des Textschlusses zur vergleichenden Analyse an, da hier - bei unterstellter Freiheit des einzelnen Autors - ein eigenständiges Achtergewicht gesetzt werden kann. Das Kapitel 6 befasst sich mit den Werken Hartmanns von Aue. Dieses prominente Oeuvre wird gewählt, um die Analyse des Textendes gleichsam auch im Zentrum der altgermanistischen Debatte vorzunehmen. Für Hartmanns Artusromane kann das Spezifische seiner Schlussgestaltung präzise herausgearbeitet werden, da seine Vorlagen bekannt sind. Hinsichtlich der geistlichen Erzählungen wird zu fragen sein, ob sie auch in ihrer Schlussgestaltung ein spezifisch geistliches Profil zeigen, das sie von den Artusromanen abhebt. In Kapitel 7 wird im Interesse einer gewissen zeitlichen Ausgewogenheit eine Gattung behandelt, deren Blütezeit ins spätere Mittelalter fällt. Hier bieten sich die schwankhaften Verserzählungen mit Ehebruchthematik an. Das Schlusskapitel zieht ein Fazit und entwirft in Grundzügen eine Poetologie des Textendes für erzählende deutschsprachige Texte des Mittelalters, indem es die Erkenntnisse, die an Texten, die in einem Zeitraum von mehr als sechs Jahrhunderten entstanden sind, bündelt und von einem eher theoretischen Standpunkt aus vergleichend erfasst. Daneben bietet es einen Ausblick auf die historische Entwicklung des Textendes seit dem 16. Jahrhundert und diskutiert weitere Forschungsperspektiven. V,441 Seiten, gebunden (Studien zur historischen Poetik; Band 19/Universitätsverlag Winter 2018)Bestell-Nr.: 14672
ISBN-13: 9783825364359
ISBN-10: 3825364356
Erscheinungsjahr: 2018
ISBN-13: 9783825364359
ISBN-10: 3825364356
Erscheinungsjahr: 2018
Weitere Bücher der Reihe »Studien zur historischen Poetik«
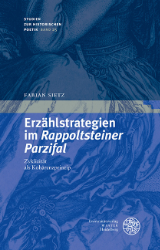
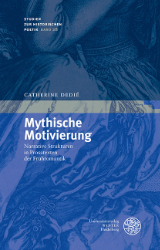

Strittmatter, Ellen
Poetik des Phantasmas
Eine imaginationstheoretische Lektüre der Werke Hartmanns von Aue
Poetik des Phantasmas
Eine imaginationstheoretische Lektüre der Werke Hartmanns von Aue
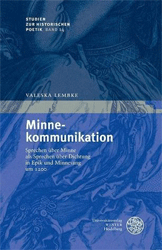
Lembke, Valeska
Minnekommunikation
Sprechen über Minne als Sprechen über Dichtung in Epik und Minnesang um 1200 …
Minnekommunikation
Sprechen über Minne als Sprechen über Dichtung in Epik und Minnesang um 1200 …
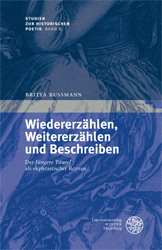
Bußmann, Britta
Wiedererzählen, Weitererzählen und Beschreiben
Der "Jüngere Titurel" als ekphrastischer Roman
Wiedererzählen, Weitererzählen und Beschreiben
Der "Jüngere Titurel" als ekphrastischer Roman
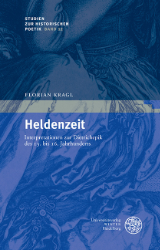
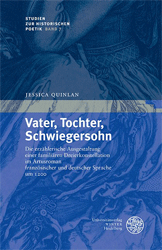
Quinlan, Jessica
Vater, Tochter, Schwiegersohn
Die erzählerische Ausgestaltung einer familiären Dreierkonstellation im Artusroman …
Vater, Tochter, Schwiegersohn
Die erzählerische Ausgestaltung einer familiären Dreierkonstellation im Artusroman …
Weitere Bücher im Sachgebiet »Mediävistik«
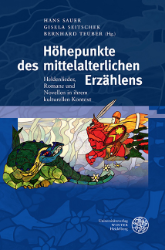
Höhepunkte des mittelalterlichen Erzählens
Heldenlieder, Romane und Novellen in ihrem kulturellen Kontext
Heldenlieder, Romane und Novellen in ihrem kulturellen Kontext
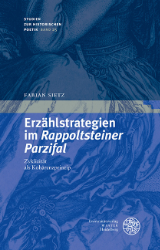


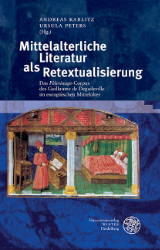
Mittelalterliche Literatur als Retextualisierung
Das 'Pèlerinage'-Corpus des Guillaume de Deguileville im europäischen Mittelalter …
Das 'Pèlerinage'-Corpus des Guillaume de Deguileville im europäischen Mittelalter …
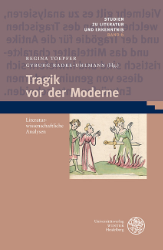

Die religiösen Dichtungen des 11. und 12. Jahrhunderts. Band II
Band II: Die Dichtungen in ungleichzeiligen Langzeilenstrophen
Band II: Die Dichtungen in ungleichzeiligen Langzeilenstrophen

Strittmatter, Ellen
Poetik des Phantasmas
Eine imaginationstheoretische Lektüre der Werke Hartmanns von Aue
Poetik des Phantasmas
Eine imaginationstheoretische Lektüre der Werke Hartmanns von Aue