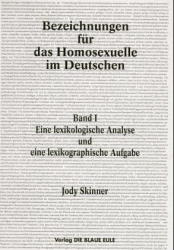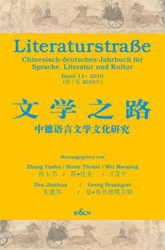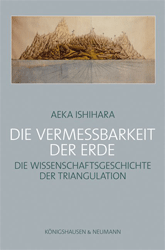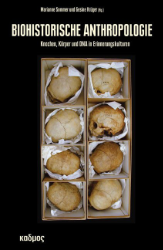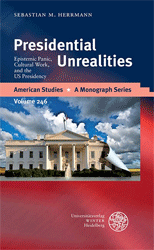Kundenlogin
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.
Wenn Sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich hier registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier ein neues Passwort anfordern.

Willi, Andrea
Arthur Schnitzlers Roman »Der Weg ins Freie«
Eine Untersuchung zur Tageskritik und ihren zeitgenössischen Bezügen. Die Arbeit versteht sich als dokumentarischer, empirischer Beitrag zur Darstellung des Verhältnisses zwischen Werk und Rezeption. Aus dem Inhalt: I. Juden-, Kunst- und Lebensfrage; II. Der Antisemitismus; III. Die Assimilation; IV. Der Zionismus; V. Das Weib als Wille und Vorstellung? Anhang: Die Rezensionen in der Reihenfolge ihres Erscheinens. - Bei der Betrachtung der Beziehungen zwischen Schnitzlers Roman "Der Weg ins Freie" und den Tagesrezensionen sollen in erster Linie Schnitzlers ästhetische Transkriptionen der Wirklichkeit, sodann das Verhältnis der künstlerischen Wirklichkeit zu der außerliterarischen Wirklichkeit, die sich in den Rezensionen manifestiert, untersucht werden. Die Wirklichkeit, aus der der Stoff ist und diejenige, zu der das Werk geworden ist, stehen sich gegenüber. Die Wechselwirkung zwischen außerliterarischer und literarischer Wirklichkeit, auf der das Kunstwerk beruht und wodurch seine künstlerische Wirklichkeit zum Spiegel der realen Wirklichkeit wird, ist auch im Roman "Der Weg ins Freie" zum wesentlichen Strukturelement geworden. Das erste Kapitel der Arbeit dient einer Standortbestimmung. Politisch und gesellschaftlich manifest werdende Umbrüche sind Anlass zu Diskussionen der Begriffe wie 'Heimat', 'Feindesland', 'Jude', 'Kunst' und 'Frau'. Nicht zufällig lässt Schnitzler die Aufbruchs-Gespräche im jüdischen Kreis stattfinden, waren doch die Juden "Symbol dieser Gesellschaft" (Arendt) um die Jahrhundertwende. Die folgenden Kapitel demonstrieren die Notwendigkeit der Diskussionen, sie thematisieren aber auch Schnitzlers Kritik an den Lösungsvorschlägen. Die Arbeit versteht sich als dokumentarischer, empirischer Beitrag zur Darstellung des Verhältnisses zwischen Werk und Rezeption. Der Vergleich der literatur- und ideologiekritischen Aussagen der Rezensionen mit dem literarischen Werk weist auf die der Literaturkritik immanenten Beziehungen zum literarischen Werk. Er dankt es vor allem mit wechselseitigen Erleuchtungen bezüglich Werk und Rezeption. XII,306 Seiten, broschiert (Beiträge zur neueren Literaturgeschichte. Folge 3; Band 91/Universitätsverlag Winter 1989) leichte Lagerspuren
Bestell-Nr.: 14734
ISBN-13: 9783533041344
ISBN-10: 3533041344
Erscheinungsjahr: 1989
ISBN-13: 9783533041344
ISBN-10: 3533041344
Erscheinungsjahr: 1989
Reihe: Beiträge zur neueren Literaturgeschichte. Folge 3
Autor*in: Andrea Willi
Sprache: Deutsch
Zustand: Wie neu, leichte Lagerspuren
Autor*in: Andrea Willi
Sprache: Deutsch
Zustand: Wie neu, leichte Lagerspuren
Weitere Bücher der Reihe »Beiträge zur neueren Literaturgeschichte. Folge 3«

Craciun, Ioana
Historische Dichtergestalten im zeitgenössischen deutschen Drama
Untersuchungen zu Theaterstücken von Tankred Dorst, Günter Grass, Martin Walser …
Historische Dichtergestalten im zeitgenössischen deutschen Drama
Untersuchungen zu Theaterstücken von Tankred Dorst, Günter Grass, Martin Walser …

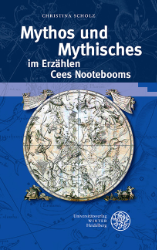


Ikonographie des Terrors?
Formen ästhetischer Erinnerung an den Terrorismus in der Bundesrepublik 1978-2008 …
Formen ästhetischer Erinnerung an den Terrorismus in der Bundesrepublik 1978-2008 …

Literatur - Macht - Gesellschaft
Neue Beiträge zur theoretischen Modellierung des Verhältnisses von Literatur …
Neue Beiträge zur theoretischen Modellierung des Verhältnisses von Literatur …

Port, Ariane
Raum - Fokalisation - Polyphonie
Narratologische Analysen dramatischer Darstellungsformen an Textbeispielen von …
Raum - Fokalisation - Polyphonie
Narratologische Analysen dramatischer Darstellungsformen an Textbeispielen von …

Hoge, Boris
Schreiben über Russland
Die Konstruktion von Raum, Geschichte und kultureller Identität in deutschen …
Schreiben über Russland
Die Konstruktion von Raum, Geschichte und kultureller Identität in deutschen …

Irsigler, Ingo
Überformte Realität
Konstruktionen von Geschichte und Person im westdeutschen Roman der 1950er Jahre …
Überformte Realität
Konstruktionen von Geschichte und Person im westdeutschen Roman der 1950er Jahre …
Weitere Bücher im Sachgebiet »Literatur von der Jahrhundertwende bis 1933«

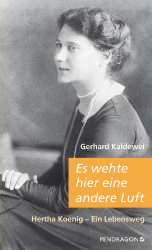

Specht, Benjamin
›Wurzel allen Denkens und Redens‹
Die Metapher in Wissenschaft, Weltanschauung, Poetik und Lyrik um 1900
›Wurzel allen Denkens und Redens‹
Die Metapher in Wissenschaft, Weltanschauung, Poetik und Lyrik um 1900
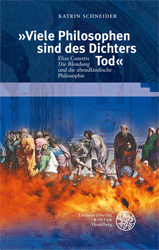
Schneider, Katrin
»Viele Philosophen sind des Dichters Tod«
Elias Canettis "Die Blendung" und die abendländische Philosophie
»Viele Philosophen sind des Dichters Tod«
Elias Canettis "Die Blendung" und die abendländische Philosophie
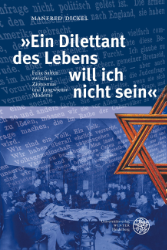
Dickel, Manfred
»Ein Dilettant des Lebens will ich nicht sein«
Felix Salten zwischen Zionismus und Jungwiener Moderne
»Ein Dilettant des Lebens will ich nicht sein«
Felix Salten zwischen Zionismus und Jungwiener Moderne
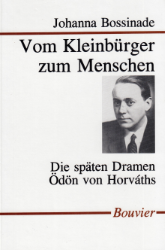
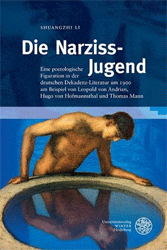
Li, Shuangzhi
Die Narziss-Jugend
Eine poetologische Figuration in der deutschen Dekadenz-Literatur um 1900 am …
Die Narziss-Jugend
Eine poetologische Figuration in der deutschen Dekadenz-Literatur um 1900 am …

Scheffler, Sandy
Operation Literatur
Zur Interdependenz von literarischem Diskurs und Schmerzdiskurs im 'Prager Kreis' …
Operation Literatur
Zur Interdependenz von literarischem Diskurs und Schmerzdiskurs im 'Prager Kreis' …
![Buchcover Die Missgeschickten. [Kommentierte Ausgabe]](/images/cover/130230.png)